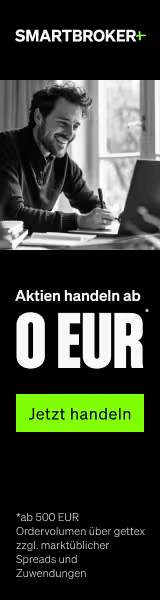Hauptversammlung der solarhybrid AG stimmt allen Tagungsordnungspunkten zu, Michael F. Spitz wird neuer Vorstand für das Kapitalmanagement
Das Solarstrom-Kraftwerk FinowTower wird um 60,2 Megawatt erweitert und zur größten PV-Anlage EuropasDie Geschäftsentwicklung der im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notierten solarhybrid AG (Markranstädt) und die auf der ordentlichen Hauptversammlung am 31.08.2011 vorgestellten Ziele fanden eine positive Resonanz bei den Aktionären, berichtet das Photovoltaik-Unternehmen in einer Pressemitteilung.
Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat folgten die Aktionäre mit nahezu 100 Prozent der vertretenen Stimmen allen Anträgen der Unternehmensführung.
Brilon wird neuer Unternehmenssitz
Ferner beschloss die Hauptversammlung die Verlegung des Geschäftssitzes von Markranstädt nach Brilon in Nordrhein-Westfalen, wo bisher die Verwaltung des Unternehmens in einer Niederlassung bestand. Zudem wurde die PricewaterhouseCoopers AG in Stuttgart zum Wirtschaftsprüfer für den Einzel- und Konzernabschluss des Jahres 2011 gewählt.
Fokussierung auf Entwicklung, Bau, Finanzierung und Vermarktung von Photovoltaik-Kraftwerken
Der Vorstandsvorsitzende Tom Schröder erläuterte in seinem Bericht ausführlich das Geschäftsmodell und die Perspektiven der solarhybrid AG im In- und Ausland. Besonders hervorgehoben wurde die Fokussierung des Geschäftes auf Entwicklung, Bau, Finanzierung und Vermarktung von Photovoltaik-Kraftwerken nach dem Verkauf der Sparten Photovoltaik-Vertrieb und Solarthermie im Juli dieses Jahres.
Ehemaliger Ralos-Manager wird CIO
Der Aufsichtsrat der solarhybrid AG hat Herrn Michael F. Spitz (42) als Chief Investment Officer (CIO) in den Vorstand berufen. Mit Wirkung zum 1. September 2011 übernimmt Spitz die Verantwortung für den Geschäftsbereich Capital Management. Er war in die solarhybrid Gruppe im März 2011 als Geschäftsführer der solar hybrid capital management GmbH eingetreten.
Zuvor war Spitz Mitglied der Geschäftsleitung der Ralos Projects GmbH, die ebenfalls im Photovoltaik-Markt aktiv ist. Davor war er in leitender Position im Investment Banking bei Nomura, Credit Suisse, Commerzbank und Dresdner Kleinwort in London, Moskau und Frankfurt tätig.
Harald Petersen, Vorsitzender des Aufsichtsrats der solarhybrid AG: „Mit Michael Spitz gewinnen wir einen Vorstand mit ausgewiesener internationaler Vertriebserfahrung und Kontakten im Investment Banking. Dies ist eine konsequente Weiterentwicklung der Wertschöpfungskette, die wir unseren Kunden über die solar hybrid capital management GmbH anbieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“
Prognose konkretisiert: Bis zu 350 Millionen Euro Umsatz erwartet
Im laufenden Jahr wurden nach Angaben des Unternehmens bereits 51 Megawatt (MWp) durch solarhybrid ans Netz angeschlossen. Aktuell seien 149 MWp in Bau und bis Jahresende sollen insgesamt rund 220 MWp ans Netz angeschlossen werden.
Das Unternehmen geht daher davon aus, dass der Umsatz 2011 am oberen Ende der bisher genannten Prognose-Spanne von 300 Millionen Euro bis 350 Millionen Euro liegen wird. Auch beim EBIT 2011 wird nun das obere Ende der Prognose von 10 Millionen Euro bis 15 Millionen Euro erwartet (inklusive der Ergebnisbelastungen aus aufgegebenen Geschäftsbereichen).
Das Solarstrom-Kraftwerk FinowTower wird um 60,2 Megawatt erweitert und zur größten PV-Anlage EuropasDie Geschäftsentwicklung der im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notierten solarhybrid AG (Markranstädt) und die auf der ordentlichen Hauptversammlung am 31.08.2011 vorgestellten Ziele fanden eine positive Resonanz bei den Aktionären, berichtet das Photovoltaik-Unternehmen in einer Pressemitteilung.
Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat folgten die Aktionäre mit nahezu 100 Prozent der vertretenen Stimmen allen Anträgen der Unternehmensführung.
Brilon wird neuer Unternehmenssitz
Ferner beschloss die Hauptversammlung die Verlegung des Geschäftssitzes von Markranstädt nach Brilon in Nordrhein-Westfalen, wo bisher die Verwaltung des Unternehmens in einer Niederlassung bestand. Zudem wurde die PricewaterhouseCoopers AG in Stuttgart zum Wirtschaftsprüfer für den Einzel- und Konzernabschluss des Jahres 2011 gewählt.
Fokussierung auf Entwicklung, Bau, Finanzierung und Vermarktung von Photovoltaik-Kraftwerken
Der Vorstandsvorsitzende Tom Schröder erläuterte in seinem Bericht ausführlich das Geschäftsmodell und die Perspektiven der solarhybrid AG im In- und Ausland. Besonders hervorgehoben wurde die Fokussierung des Geschäftes auf Entwicklung, Bau, Finanzierung und Vermarktung von Photovoltaik-Kraftwerken nach dem Verkauf der Sparten Photovoltaik-Vertrieb und Solarthermie im Juli dieses Jahres.
Ehemaliger Ralos-Manager wird CIO
Der Aufsichtsrat der solarhybrid AG hat Herrn Michael F. Spitz (42) als Chief Investment Officer (CIO) in den Vorstand berufen. Mit Wirkung zum 1. September 2011 übernimmt Spitz die Verantwortung für den Geschäftsbereich Capital Management. Er war in die solarhybrid Gruppe im März 2011 als Geschäftsführer der solar hybrid capital management GmbH eingetreten.
Zuvor war Spitz Mitglied der Geschäftsleitung der Ralos Projects GmbH, die ebenfalls im Photovoltaik-Markt aktiv ist. Davor war er in leitender Position im Investment Banking bei Nomura, Credit Suisse, Commerzbank und Dresdner Kleinwort in London, Moskau und Frankfurt tätig.
Harald Petersen, Vorsitzender des Aufsichtsrats der solarhybrid AG: „Mit Michael Spitz gewinnen wir einen Vorstand mit ausgewiesener internationaler Vertriebserfahrung und Kontakten im Investment Banking. Dies ist eine konsequente Weiterentwicklung der Wertschöpfungskette, die wir unseren Kunden über die solar hybrid capital management GmbH anbieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“
Prognose konkretisiert: Bis zu 350 Millionen Euro Umsatz erwartet
Im laufenden Jahr wurden nach Angaben des Unternehmens bereits 51 Megawatt (MWp) durch solarhybrid ans Netz angeschlossen. Aktuell seien 149 MWp in Bau und bis Jahresende sollen insgesamt rund 220 MWp ans Netz angeschlossen werden.
Das Unternehmen geht daher davon aus, dass der Umsatz 2011 am oberen Ende der bisher genannten Prognose-Spanne von 300 Millionen Euro bis 350 Millionen Euro liegen wird. Auch beim EBIT 2011 wird nun das obere Ende der Prognose von 10 Millionen Euro bis 15 Millionen Euro erwartet (inklusive der Ergebnisbelastungen aus aufgegebenen Geschäftsbereichen).