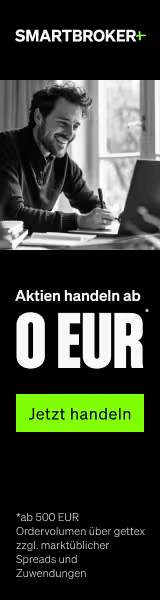VW macht erstmals mehr Umsatz als Daimler
Volkswagen hängt alle ab: Die Wolfsburger haben ihren Konkurrenten Daimler in einem Ranking vom Spitzenplatz der umsatzstärksten deutschen Unternehmen verdrängt. Die Konjunktur-Abkühlung zeigt ihre Wirkung: Die deutschen Unternehmen wachsen nicht mehr so stark wie im Vorjahr.
Berlin - Seinen Spitzenplatz verlor Daimler zeigen durch den Verkauf von Chrysler. In dem Ranking der "Welt" listete das Blatt die 500 umsatzstärksten deutschen Unternehmen auf. Volkswagen ist demzufolge erstmals die Nummer eins in Deutschland.
Als einzige Firma kommt VW auf einen dreistelligen Milliardenumsatz - nämlich auf rund 109 Milliarden Euro. Mit 99,4 Milliarden liegt Daimler im Ranking knapp dahinter. Auf Platz drei folgt der Münchner Technologiekonzern Siemens zeigen mit 72,4 Milliarden Euro.
Größter Arbeitgeber ist dem Ranking zufolge die Deutsche Post zeigen mit gut 470.000 Mitarbeitern vor Siemens (398.000) und VW (329.000).
Im vergangenen Jahr sind die 500 größten Unternehmen allerdings nicht mehr so stark gewachsen wie 2006. Ihre Umsätze legten nur noch um 5,3 Prozent zu, ein Jahr zuvor waren es noch mehr als 11 Prozent.
Im Jahr 2006 bescherten die steigenden Energiepreise den Energieversorgern traumhafte Gewinnmargen, schreibt das Blatt. 2007 stehe dagegen nur noch eine "schwarze Null". Nur die Milliardenkonzerne im Maschinenbau und in der Metallindustrie hatten im vergangen Jahr mehr als zehn Prozent zugelegt.
cvk/Reuters
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,561322,00.html
Volkswagen hängt alle ab: Die Wolfsburger haben ihren Konkurrenten Daimler in einem Ranking vom Spitzenplatz der umsatzstärksten deutschen Unternehmen verdrängt. Die Konjunktur-Abkühlung zeigt ihre Wirkung: Die deutschen Unternehmen wachsen nicht mehr so stark wie im Vorjahr.
Berlin - Seinen Spitzenplatz verlor Daimler zeigen durch den Verkauf von Chrysler. In dem Ranking der "Welt" listete das Blatt die 500 umsatzstärksten deutschen Unternehmen auf. Volkswagen ist demzufolge erstmals die Nummer eins in Deutschland.
Als einzige Firma kommt VW auf einen dreistelligen Milliardenumsatz - nämlich auf rund 109 Milliarden Euro. Mit 99,4 Milliarden liegt Daimler im Ranking knapp dahinter. Auf Platz drei folgt der Münchner Technologiekonzern Siemens zeigen mit 72,4 Milliarden Euro.
Größter Arbeitgeber ist dem Ranking zufolge die Deutsche Post zeigen mit gut 470.000 Mitarbeitern vor Siemens (398.000) und VW (329.000).
Im vergangenen Jahr sind die 500 größten Unternehmen allerdings nicht mehr so stark gewachsen wie 2006. Ihre Umsätze legten nur noch um 5,3 Prozent zu, ein Jahr zuvor waren es noch mehr als 11 Prozent.
Im Jahr 2006 bescherten die steigenden Energiepreise den Energieversorgern traumhafte Gewinnmargen, schreibt das Blatt. 2007 stehe dagegen nur noch eine "schwarze Null". Nur die Milliardenkonzerne im Maschinenbau und in der Metallindustrie hatten im vergangen Jahr mehr als zehn Prozent zugelegt.
cvk/Reuters
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,561322,00.html