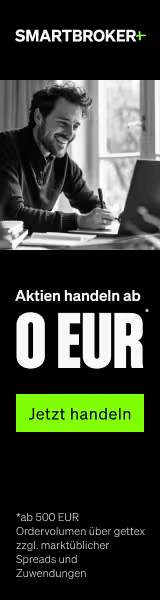Verbraucherpreise
Teuerungswelle in Deutschland ebbt ab
Den Bundesbürgern ist im August ein weiterer Teuerungsschub erspart geblieben: Ersten Daten zufolge gingen die Lebenshaltungskosten wegen gesunkener Energiepreise leicht zurück. Auch auf Jahressicht erwarten Experten Entspannung - unter Vorbehalt.
Die Abnahme bei den Lebenshaltungskosten betrug rund im Vergleich zum Juli 0,3 bis 0,4 Prozent. Auf Jahressicht lag die Teuerung jedoch immer noch zwischen 3,1 und 3,4 Prozent, nachdem sie im Juli noch mit 3,3 Prozent auf dem höchsten Niveau seit 15 Jahren verharrte. Im Verlauf des Mittwochs wollte das Statistische Bundesamt seine Schätzung für Deutschland vorlegen, wenn auch die Daten aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen vorliegen. Experten gehen davon aus, dass die Teuerungsrate bei 3,2 Prozent liegen dürfte.
Vor allem Mineralölprodukte wurden günstiger: So verbilligten sich Kraftstoffe binnen eines Monats zwischen 5,9 und 6,3 Prozent, bei Heizöl lag der Rückgang zwischen 8,6 und 10,7 Prozent. Auf Jahressicht kosteten Kraftstoffe jedoch immer noch 11 bis 13,1 Prozent mehr, bei Heizöl mussten 39 bis 49,4 Prozent mehr bezahlt werden.
In den vergangenen Wochen gab der Ölpreis wieder deutlich nach. Erreichte er Mitte Juli noch ein Hoch von mehr als 147 $ je Fass, sind es inzwischen etwa 30 $ weniger. Allerdings schlug Gas stärker zu Buche, nachdem mehrere Versorger ihre Preise erhöht hatten. Auch Lebensmittel wurden unter dem Strich billiger: So kosteten Obst und Gemüse weniger. Für Fleisch mussten die Verbraucher dagegen mehr ausgeben.
"Gipfel der Inflation erreicht"
Trotz des jüngsten Rückgangs liegt die Inflationsrate deutlich über dem Ziel der EZB, die bei knapp zwei Prozent Preisstabilität gewährleistet sieht. Nach Einschätzung von Analysten dürften die Teuerungsraten aber ab Herbst zurückgehen, wenn sich Basiseffekte bemerkbar machten. "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Gipfel bei der Inflation jetzt gesehen haben, ist relativ hoch", sagte Stefan Schilbe von HSBC Trinkaus. "Das gilt aber nur unter der Prämisse, dass der Ölpreis nicht wieder signifikant steigt."
Eine Zinssenkung der EZB stehe derzeit aber wohl nicht zur Debatte, sagte Gregor Eder von der Dresdner Bank: "Ich will aber nicht ausschließen, dass sich im kommenden Monat die Zinssenkungsdiskussion weiter verschärft, wenn sich die Konjunkturdaten weiter verschlechtern und die Inflation sinkt."
http://www.ftd.de/politik/deutschland/:Verbraucherpreise_Teuerungswelle_in_Deutschland_ebbt_ab/406122.html
Teuerungswelle in Deutschland ebbt ab
Den Bundesbürgern ist im August ein weiterer Teuerungsschub erspart geblieben: Ersten Daten zufolge gingen die Lebenshaltungskosten wegen gesunkener Energiepreise leicht zurück. Auch auf Jahressicht erwarten Experten Entspannung - unter Vorbehalt.
Die Abnahme bei den Lebenshaltungskosten betrug rund im Vergleich zum Juli 0,3 bis 0,4 Prozent. Auf Jahressicht lag die Teuerung jedoch immer noch zwischen 3,1 und 3,4 Prozent, nachdem sie im Juli noch mit 3,3 Prozent auf dem höchsten Niveau seit 15 Jahren verharrte. Im Verlauf des Mittwochs wollte das Statistische Bundesamt seine Schätzung für Deutschland vorlegen, wenn auch die Daten aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen vorliegen. Experten gehen davon aus, dass die Teuerungsrate bei 3,2 Prozent liegen dürfte.
Vor allem Mineralölprodukte wurden günstiger: So verbilligten sich Kraftstoffe binnen eines Monats zwischen 5,9 und 6,3 Prozent, bei Heizöl lag der Rückgang zwischen 8,6 und 10,7 Prozent. Auf Jahressicht kosteten Kraftstoffe jedoch immer noch 11 bis 13,1 Prozent mehr, bei Heizöl mussten 39 bis 49,4 Prozent mehr bezahlt werden.
In den vergangenen Wochen gab der Ölpreis wieder deutlich nach. Erreichte er Mitte Juli noch ein Hoch von mehr als 147 $ je Fass, sind es inzwischen etwa 30 $ weniger. Allerdings schlug Gas stärker zu Buche, nachdem mehrere Versorger ihre Preise erhöht hatten. Auch Lebensmittel wurden unter dem Strich billiger: So kosteten Obst und Gemüse weniger. Für Fleisch mussten die Verbraucher dagegen mehr ausgeben.
"Gipfel der Inflation erreicht"
Trotz des jüngsten Rückgangs liegt die Inflationsrate deutlich über dem Ziel der EZB, die bei knapp zwei Prozent Preisstabilität gewährleistet sieht. Nach Einschätzung von Analysten dürften die Teuerungsraten aber ab Herbst zurückgehen, wenn sich Basiseffekte bemerkbar machten. "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Gipfel bei der Inflation jetzt gesehen haben, ist relativ hoch", sagte Stefan Schilbe von HSBC Trinkaus. "Das gilt aber nur unter der Prämisse, dass der Ölpreis nicht wieder signifikant steigt."
Eine Zinssenkung der EZB stehe derzeit aber wohl nicht zur Debatte, sagte Gregor Eder von der Dresdner Bank: "Ich will aber nicht ausschließen, dass sich im kommenden Monat die Zinssenkungsdiskussion weiter verschärft, wenn sich die Konjunkturdaten weiter verschlechtern und die Inflation sinkt."
http://www.ftd.de/politik/deutschland/:Verbraucherpreise_Teuerungswelle_in_Deutschland_ebbt_ab/406122.html