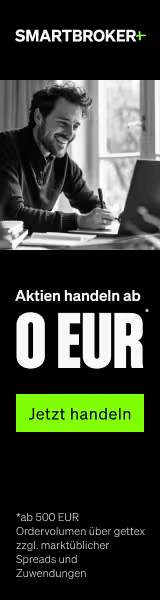Fastfood
Lizenz zum Abkassieren für Subway
05.05.2008 Christine Weißenborn
http://www.wiwo.de/unternehmer-maerkte/lizenz-zum-abkassieren-fuer-subway-291546/
Bei den Kunden hat die US-Sandwich-Kette Subway einen besseren Ruf als McDonald’s. Doch hinter den Tresen gärt es. Restaurantbetreiber klagen über rücksichtslose Lizenzverträge – und Mitarbeiter über Hungerlöhne.
Der Tag in Bremerhaven ist grau und verregnet. Im historischen Hafen dümpeln restaurierte Kutter gegen die Kaimauer. Zwischen den alten Kähnen verlaufen sich wenige Touristen. Im ersten Stock des Einkaufszentrums Hanse Carré liegt still ein Subway-Restaurant. Obwohl es Mittag ist, gibt es kaum Gäste. Die Bedienung lächelt gelangweilt – über Schinken, Gurken, Käse und Baguettes herrscht Ruh’.
Gut möglich, dass es dem Subway-Laden mit der Nummer 34.385 bald noch schlechter geht. Denn im Umkreis von ein paar Hundert Metern sind zwei neue Buden geplant. Noch vor vier Jahren glaubte Bernd Nacke, mit der Eröffnung seines Subway-Restaurants im Hanse Carré einen erfolgreichen Schritt in die Selbstständigkeit zu tun. Er kündigte seinen Job als Versicherungsmakler, seine Lebensgefährtin gab ihre Beschäftigung als Altenpflegerin auf, zusammen investierten die beiden 140.000 Euro, um Subway-Restaurantbetreiber zu werden. Jetzt könnten ihnen, obwohl das Geschäft schon miserabel läuft, zwei weitere Läden den Garaus machen. „Die Subway-Organisation“, schimpft Nacke, „ist ein reines Inkassobüro.“
Das Gefühl, in die Fänge eines Geldeintreibers geraten zu sein, eint offenbar die Mehrheit der rund 300 Subway-Restaurantbetreiber in Deutschland. Anfang April verweigerte der Deutsche Franchise-Verband der Sandwichkette zum zweiten Mal in Folge die Vollmitgliedschaft, weil mehr als die Hälfte der Betreiber unzufrieden mit Subway ist. Je länger der Konzern Deutschland mit Baguette-Belegstationen überzieht, desto größer wird der Unmut derer, die eine Lizenz zum Stullenschmieren erwarben – und sich nun angeschmiert fühlen.
Statt wie erhofft vom Management der US-Sandwich-Kette betreut zu werden, fühlen sich die meisten Restaurantbetreiber wie anonyme Nummern in einem kaum durchschaubaren System. Unternehmerisch meist unerfahren, merken viele zu spät, dass sie sich mit ihrer Unterschrift unter den Lizenzvertrag auf ein schlechtes Geschäft eingelassen haben. Analysen des Subway-Managements über Standorte einzelner Restaurants erweisen sich oft als mangelhaft. Bei seiner aggressiven Expansion in Deutschland gewährt Subway Restaurantbetreibern keinen Schutz vor neuen Lizenznehmern. Kommt es zum Streit, entgleitet der US-Konzern wie eine glitschige Gewürzgurke. Eine rechtsverbindliche Fassung der Franchiseverträge gab es bis vor einem Jahr nur auf Englisch.
Vorläufiger Tiefpunkt im Verhältnis zwischen Betreibern und Subway-Management ist die Umstellung der Erstlizenzgebühr in Höhe von 10.000 US-Dollar auf 10.000 Euro vom kommenden Juli an, die US-Konzerndirektor Don Fertman Mitte März bekanntgab. Das entspricht einer Erhöhung um 50 Prozent. „Die Expansion von Subway in Deutschland“, sagt Rechtsanwalt Christian Prasse aus Ahrensburg in Schleswig-Holstein, der den Bremerhavener Subway-Betreiber Nacke gegenüber der US-Kette vertritt, „findet auf dem Rücken der ersten Franchisenehmergeneration statt.“
Pizza, Stullen und Buletten Bild vergrößern Pizza, Stullen und Buletten
Die Idee, ohne Fachwissen und unternehmerisches Know-how schnell Geld zu verdienen, indem man belegte Brötchen verkauft, fällt auf fruchtbaren Boden in Zeiten von Hartz IV und rückläufigen Reallöhnen. An Nachwuchs mangelt es Subway in Deutschland nicht. Rund 2000 Interessenten bewerben sich nach Angaben der Kette jeden Monat um eine Lizenz. Und wenn die Kalkulation nicht aufgeht und die Kostenlast der Subway-Zentrale zu groß wird, bleibt immer noch der Ausweg, den wirtschaftlichen Druck an die Mitarbeiter weiterzugeben. Auch die sind häufig froh, einen Job gefunden zu haben – und akzeptieren nicht selten Hungerlöhne von unter sechs Euro pro Stunde. Der seit Dezember 2007 gültige Tariflohn für die sogenannte Systemgastronomie, zu denen Fastfoodketten zählen, liegt bei 7,50 Euro – Subway ist regelmäßig weit darunter.
Dass von dem Elend bisher kaum etwas an die Öffentlichkeit drang, verdankt Subway der offenkundigen Zufriedenheit der Kundschaft mit den saftig-herzhaft und prall gefüllten Baguettes. So schneidet Subway nach einer Erhebung des Kölner Marktforschungsinstituts Psychonomics bei den Gästen in wichtigen Belangen um ein Vielfaches besser ab als die Konkurrenten McDonald’s und Burger King.
Dabei ist das Konzept der Kette mit dem grün-weiß-gelben Schriftzug an Einfachheit kaum zu überbieten. Im Gegensatz zum Bäcker um die Ecke, der Schinken-, Käse- und sonstige Brötchen in überschaubarer Auswahl hinter Glas dünstelnd feilbietet, setzt Subway auf direkte Zubereitung und Supervielfalt. Jeder Kunde wählt am Tresen eine bestimmte Sorte frisch gebackenen Baguettes von 15 oder 30 Zentimeter Länge, das ein Subway-Mitarbeiter sodann mit allem vollstopft, was gewünscht wird und zwischen zwei Brothälften passt: vom vorgegrillten Hühnchenfleisch über Thunfischmasse bis zu höllenscharfen Pepperoni, alles getränkt in süß-saurer, klarer oder rosafarbener Soße und versenkt in Salat und Gemüse. Wem die Entscheidung schwer fällt, kann sich im Internet mithilfe eines „Sandwich-Konfigurators“ seinen „Sub“ zusammenstellen. Mit dem Salat und dem Gemüse suggeriert Subway gesunde Ernährung, das fördert das Image. Lediglich die Preise bis zu vier Euro pro „Konfiguration“ kommen weniger gut an.
Der Einfall, die Mägen der Welt mit konfektionierter Stullennahrung zu füllen, geht zurück auf Fred DeLuca, einen im New Yorker Stadtteil Brooklyn geborenen Sohn italienischer Einwanderer. Der eröffnete, um sein Psychologiestudium zu finanzieren, 1965 als 17-jähriger Highschoolabsolvent in Bridgeport im US-Staat Conneticut einen Sandwichladen, indem er mit 1000 Dollar Starthilfe eines Freundes einfach einen Raum mietete, einen Tresen baute und ein paar Lebensmittel kaufte. DeLuca zog sein Studium durch, avancierte danach aber zum unangefochtenen Brötchenkönig, der weltweit inzwischen 29.200 identische Schnellrestaurants steuert, die für rund elf Milliarden Dollar Einnahmen (Gewinn unbekannt) sorgen – nach Umsatz die zweitgrößte, nach Filialen die drittgrößte Fastfood-Kette auf dem Globus.
Möglich machte Gründer DeLuca die rasante Expansion durch Franchise. Das heißt: Subway bietet die Geschäftsidee interessierten Existenzgründern, den sogenannten Franchisenehmern, gegen Zahlung eines bestimmten monatlichen Betrages zur Nachahmung an. Diese betreiben die Restaurants auf eigenes wirtschaftliches Risiko. Gut 900 derartige Franchisegeber zählt der Deutsche Franchise-Verband inzwischen hierzulande – und wacht darüber, dass die rund 250 Mitgliedsunternehmen kein Schindluder mit ihren Geschäftspartnern treiben.
Genau aus diesem Grund schafft Subway es bis heute nicht, unter das imagefördernde Dach des Verbandes zu schlüpfen. Und das, obwohl DeLucas Leute in Deutschland seit nunmehr neun Jahren unentwegt Läden aus dem Boden stampfen und bis 2011 die heutige Zahl von 595 auf 1500 hochschrauben wollen. Mit welchen dubiosen Methoden und Versprechungen sie dabei vorgehen, zeigt wie kaum ein anderer der Fall des Bremerhaveners Nacke.
Die schmerzhafte Geschichte des heute 58-Jährigen als selbstständiger Unternehmer begann am 3. März 2004 mit einer Anzeige von Subway in der Bremerhavener „Nordsee-Zeitung“, in der es verlockend hieß: „Chefs gesucht“. Nacke wandte sich an einen von 16 Subway-Gebietsleitern in Deutschland, der ihn weitervermittelte an Sven Romberg und Armin Peiker, zwei vom US-Konzern beauftragte Berater in Essen. Die sollten Franchiseanwärter bei der Finanzierung unterstützen.
Damit war Nackes Leidensweg vorgezeichnet. Peiker, so erinnert sich Nacke, habe ihm im Mai 2004 telefonisch geraten, zur Sicherung des künftigen Geschäfts nicht nur ein, sondern gleich fünf bis zehn Restaurants aufzubauen. Dabei stellte der Consulter Nacke einen durchschnittlichen Umsatz von rund 30.000 Euro pro Monat je Restaurant und einen Gewinn von etwa 20 Prozent, also 6000 Euro je Lokal, in Aussicht. Das hätte gereicht, meint Nacke heute, um sich und seiner Lebensgefährtin ein auskömmliches Monatsgehalt auszubezahlen und den Laden in Schuss zu halten. Mit der Eröffnung weiterer Läden, so glaubte er, wäre sogar das richtig große Geschäft drin gewesen. Peiker bestreitet, jemals Kontakt zu Nacke gehabt zu haben.
Für den frischgebackenen Restaurantbetreiber Nacke folgte statt des dicken Reibachs schon rund ein Jahr nach Eröffnung des ersten Ladens in Bremerhaven die blanke Ernüchterung. Statt der erhofften und von, wie Nacke sagt, Berater Peiker prognostizierten 70.000 Euro im Jahr, blieben ihm in den ersten zwölf Monaten 50.000 Euro, 2006 nur noch 20.000 Euro Gewinn in der Kasse. Heute schreibt Nacke rote Zahlen. In der Not stockte er die lokalen Werbeausgaben auf fünf Prozent des Umsatzes auf, mehr als dreimal so viel wie von Subway empfohlen, klebte Plakate, verteilte Handzettel und startete Rabattaktionen. Als die Ausgaben Wirkung zeigten, entschied sich Nacke, um endlich den erhofften Geldsegen einzufahren, zwei weitere Läden zu eröffnen, einen in Cuxhaven und einen im ebenfalls niedersächsischen Nordenham. Sein Gebietsleiter David von der Vring aus Bremen genehmigte die Expansion. Nacke vertraute darauf, dass einer solchen Genehmigung in Abstimmung mit der US-Zentrale immer auch eine Standortanalyse vorausging. Um den Aufbau der beiden neuen Subway-Restaurants zu finanzieren, schloss er Leasing- und Kreditverträge in Höhe von 300.000 Euro ab.
Alles vergeblich, alles für die Katz: Die Kundschaft auch in den neuen Lokalen blieb aus. „Subway hat mich angelogen“, sagt Nacke heute. Eine Standortanalyse sei nie erfolgt. Die zusätzlichen 382.000 Euro Bruttoeinnahmen in 2007 aus den Läden in Cuxhaven und Nordenham wurden vollständig aufgefressen von Miete, Lizenzgebühren an Subway, Zinsen, Ausgaben für Strom, Werbung, Baguettes, Belegzutaten sowie Personalkosten, obwohl Nacke nur sechs Euro Stundenlohn bezahlte und mit seiner Lebensgefährtin Tag und Nacht in den drei Stores malochte. Schon Ende 2006 sah er sich nicht mehr in der Lage, die 12,5 Prozent Umsatzgebühren an Subway zu überweisen, und stellte die Zahlung ein. Im Mai 2007 kündigte ihm sein Brötchengeber alle drei Läden. Über die Wirksamkeit der Kündigung bestehen allerdings Zweifel, da Subway die Kündigung vor einem Schiedsgericht in New York erwirkt hat. Im Moment prüft der Bundesgerichtshof in einem Parallelverfahren, ob die umstrittene Schiedsgerichtsklausel in den Franchiseverträgen überhaupt Bestand hat. Ein Urteil soll Ende des Jahres erfolgen. Würde Nacke die Geschäfte abgeben, müsste er Privatinsolvenz anmelden. Zurzeit lebt er vom Arbeitslosengeld seiner Lebensgefährtin, die bisher bei ihm angestellt war.
Subway weist alle Vorwürfe Nackes zurück. „Jeder Franchisenehmer ist für seinen Standort selbst verantwortlich“, sagt Deutschland-Chef Marco Wild.
Das mag rein rechtlich so sein. Doch in der Praxis steht die unternehmerische Selbstverantwortung nur auf dem Papier. Für viele der Restaurantbetreiber erweist sich das System Subway als eine Mischung aus knebelähnlichen Lizenzverträgen, schwammigen Rechtsklauseln und lotterhaftem Management.
Egal, wie schlecht ein Subway-Laden auch läuft, die Betreiber werden immer zur Kasse gebeten. Viele Franchisegeber in Deutschland, darunter die Tiernahrungskette Fressnapf, haben nach dem Franchise-Verbandskodex einen Geldtopf für Notfälle eingerichtet, der Lizenznehmern kurzfristig bei Liquiditätsengpässen helfen soll. Bei Subway gibt es das nicht, der Konzern kassiert konstant jeden Monat die vereinbarten Summen: acht Prozent vom Umsatz als Franchisegebühr, weitere 4,5 Prozent für deutschlandweite Werbung.
Ob ein Franchisenehmer seinen Aufgaben gewachsen ist, scheint Subway nur wenig zu interessieren. Ein Berliner Restaurantbetreiber berichtet von Leidensgenossen, die direkt aus der Arbeitslosigkeit ins Geschäft mit den Stullen eingestiegen und entweder gescheitert sind oder am Existenzminimum kratzen. Subway-Deutschland-Chef Wild versichert zwar, die kaufmännischen Fähigkeiten der Kandidaten würden im Bewerbungsgespräch „abgeklopft“. Allerdings sei der „Hintergrund“ der Interessenten „sehr heterogen“. Vom Studenten über den Polizisten bis zum Karatelehrer oder ehemaligen Manager drängt alles an die Baguettes.
Das Risiko, zu scheitern, hat Subway fast vollständig auf die Restaurantbetreiber abgewälzt. Geht einer von ihnen in Konkurs, hält sich der Konzern nicht nur weitgehend schadlos. Die Zentrale in Milford im US-Staat Conneticut verdient sogar an den Pleiten mit. Wenn jemand den bankrotten Laden übernimmt, wird erneut eine Gebühr für die Eröffnungslizenz fällig. Entsprechend sind die 16 Gebietsleiter in Deutschland hemmungslos auf Expansion programmiert. Sie erhalten kein Gehalt, sondern sind am Verkauf der Lizenzen beteiligt und kassieren einen Teil der laufenden Franchisegebühren. Das führe dazu, dass „in Deutschland jeder Laden auf Teufel komm’ raus aufgemacht wird, ganz egal, ob das sinnvoll ist oder nicht“, sagt Anwalt Prasse. Die beiden für die Region Nordrhein zuständigen Gebietsleiter Markus Engels und Sascha Hörig etwa erzielen mit der ständigen Eröffnung neuer Läden ein so hohes Einkommen, dass sie in ihrem Büro in einem Gewerbegebiet bei Köln inzwischen zwölf Mitarbeiter beschäftigen können. Deutschland-Chef Wild räumt dazu nur vorsichtig ein: „Die Akquise neuer Standorte ist der größte Engpassfaktor.“
Da müssen die Bewerber nicht selten nehmen, was da ist, egal, ob das Einzugsgebiet einen Laden trägt oder nicht. Thilo Fritzsche aus Stade bei Hamburg, der seit dem 15. Juni 2005 ein Subway-Restaurant betreibt, wartet zum Beispiel noch immer auf die versprochene Standortanalyse seines Subway-Gebietsleiters. Schriftlich hat er nichts in der Hand, weder eine Analyse noch das Versprechen, eine solche zu erhalten. Sein Subway-Restaurant in Stade warf zwischenzeitlich so wenig ab, dass er Wohngeld beantragen musste. Subway stört derlei nicht, sondern expandiert einfach weiter. In den vergangenen zwölf Monaten eröffneten die Amerikaner bundesweit 170 neue Restaurants – 47 alleine seit Januar – und steigerten den Gesamtumsatz gegenüber dem Vorjahr um 34 Prozent auf 142 Millionen Euro.
Die Expansion verläuft auch deshalb so schnell, weil Subway die Bewerber massiv unter Zeitdruck setzt. Die Gebühr für die Erstlizenz von künftig 10.000 Euro wird sofort bei Vertragsunterzeichnung fällig. In den meisten Fällen gibt es zu diesem Zeitpunkt noch gar keinen Standort für die neue Subway-Bude. Die Suche nach einer geeigneten Lage, sagt Deutschland-Chef Wild, „liegt grundsätzlich in der Verantwortung des Franchisepartners“. Dafür hat der Lizenznehmer zwei Jahre Zeit. Falls er kein passendes Ladenlokal findet, verfällt die Lizenz und mit ihr die Erstlizenzgebühr. Bernd-Rüdiger Fassbender, Präsident des Deutschen Franchisenehmerverbands, nennt dies eine „Abzocke auf Lizenzbasis“.
Subway gewährt den Restaurantbetreibern keinen Gebietsschutz, bewahrt sie also nicht vor Wettbewerbern in allernächster Nähe. Zwar hat ein Franchisenehmer ein Einspruchsrecht. Am Ende entscheidet aber die US-Konzernzentrale, die weder den Standort noch den Franchisenehmer jemals persönlich zu Gesicht bekommen hat. Deutschland-Chef Wild findet nichts dabei, weil die Restaurantbetreiber ihrerseits keine Verpflichtungen eingingen, den Umsatz zu steigern. Anwalt Prasse hingegen glaubt, Subway kalkuliere bewusst, „Franchisenehmer zu verbrennen“.
Tatsächlich sind die Läden gescheiterter Subway-Betreiber heiß begehrt, weil sie häufig für die Hälfte der Investitionen zu haben sind, die die Gründer in sie gesteckt haben. Auch Gebietsleiter greifen hier gerne zu. Sie sind zwar für die Akquisition neuer Lizenznehmer zuständig, dürfen aber auch selber als Franchisenehmer auftreten.
Zugleich versuchen die Subway-Regionalfürsten, die einfachen Restaurantbetreiber eng an die Kandare zu nehmen. Als unzufriedene Lizenznehmer Anfang 2005 ein Internet-Forum gründeten, um sich auszutauschen, klinkte sich prompt ein Gebietsleiter ein und zerstörte die Vertraulichkeit. An die Stelle des Internet-Forums für die Aufmüpfigen trat im Oktober 2005 ein von Subway autorisiertes Nationales Franchisenehmerboard Germany, kurz NFBG, die offizielle Online-Plattform für Subway-Franchisenehmer. Zugang haben nur noch Lizenznehmer und Mitglieder, darunter auch Gebietsleiter. Der Mut, weiterhin seine Meinung offen zu verbreiten, berichten Teilnehmer, sei seitdem „klar zurückgegangen“. Umgekehrt musste allerdings auch Gebietsleiter Hörig schon einmal zurückstecken, nachdem er Informationen aus dem Forum an die Subway-Europa-Zentrale in Amsterdam weitergab. Dafür wurde er für alle Portalmitglieder sichtbar als „gesperrter Benutzer“ gebrandmarkt und einstimmig aus dem Forum ausgeschlossen.
Zu den größten Kritikpunkten am Subway-System zählt die Schulung der Restaurantgründer. Wer in das Geschäft mit den Sandwiches einsteigt, erhält lediglich ein zweiwöchiges Training in der Kölner Subway-Zentrale. Die weiß gestrichenen Räume am zentral gelegenen Friesenplatz sind nur über einen Hinterhofeingang zu erreichen. Das Ambiente ist spartanisch wie in einer Subway-Filiale, Plastikstühle und -tische sowie eine Deutschlandkarte mit allen hiesigen Subway-Restaurants dominieren den Eingangsbereich. Ein ehemaliger Franchisenehmer aus Hessen klagt, bei ihm habe der Unterricht sogar in leeren Räumen zwischen Umzugskartons stattgefunden. Die Kosten für Hotel, Unterkunft und Verpflegung tragen die Teilnehmer selbst, vom Kugelschreiber übers Lineal bis zum Bleistift muss jeder alles selber mitbringen.
Entsprechend karg ist auch das Lehrprogramm. In der ersten Woche lernen die künftigen Unternehmer das Abrechnungssystem bei Subway kennen, in der zweiten Woche stehen 40 Stunden Baguettebelegenüben auf dem Stundenplan. Kaufmännische Grundlagen wie Buchhaltung oder Marketing würden kaum vermittelt, berichtet ein Einsteiger, Blauäugigkeit sei kein Hindernis für den Start. „Wir haben immer in der Kaffeepause gewitzelt, dass Subway jeden nimmt, der halbwegs lesen und schreiben kann.“
Im Vergleich dazu geht es bei McDonald’s generalstabsmäßig zu. Hier absolvieren die künftigen Restaurantbetreiber ein anderthalbjähriges Trainingsprogramm – zwar unbezahlt, dafür arbeiten die meisten Kandidaten aber in ihren ursprünglichen Jobs weiter, häufig als Manager oder Unternehmensberater. Auf diese Weise bekommen sie Kenntnisse in Betriebswirtschaftslehre, Marketing und Personalorganisation vermittelt. Bei Subway müssten 14 Tage genügen, meint Deutschland-Chef Wild, „denn niemand kann unseren künftigen Partnern 18 Monate ohne Bezahlung zumuten“.
Geraten die Unwissenden in wirtschaftliche Not, bleibt ihnen nur, selber Tag und Nacht hinterm Tresen zu stehen – und den Druck an ihre Mitarbeiter weiterzugeben. Um den zwischen dem Bundesverband der Systemgastronomie und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ausgehandelten Fast-Food-Tariflohn von 7,50 Euro pro Stunde schere sich bei Subway im Gegensatz zu McDonald’s, Burger King oder Pizza Hut eigentlich niemand, sagt Valerie Nauman, Hauptgeschäftsführerin des Systemgastronomie-Verbandes. Subway gehört dem Arbeitgeberverband nicht an. Die meisten Subway-Restaurantbetreiber zahlen zwischen 5,00 und 6,50 Euro pro Stunde. Unbezahltes Probearbeiten neuer Mitarbeiter gehört zum Alltag. In Duisburg wird eine ganze Subway-Filiale nur von Auszubildenden geführt. Die verdienen laut Rainer Sodogé von der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg 515 Euro im ersten und 625 Euro im dritten Jahr – das entspricht bestenfalls vier Euro pro Stunde. „Hier wird ganz klar der Tariflohn unterschritten“, sagt Guido Zeitler, Referatsleiter bei der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. „Wenn Subway seine Betriebe in dieser Weise weitermelkt, wird das nicht lange gut gehen.“
Schlechte Noten für Subway und Burger King Bild vergrößern Schlechte Noten für Subway und Burger King
Viele Subway-Lizenznehmer fühlen sich auch rechtlich an der Nase herumgeführt. Für Argwohn sorgen Klauseln in den Lizenzverträgen, wonach bei Streitigkeiten ein Schiedsgericht in New York zuständig ist und für Subway in Deutschland die Gesetze im Fürstentum Liechtenstein gelten. Die Konstruktion hält Anwalt Prasse schlichtweg für „unwirksam“ und glaubt, dass Subway damit nur versuche, deutsches Recht zu umgehen.
In der Praxis fangen die Probleme aber schon viel früher an. So sitzt der für Deutschland zuständige Subway-Unterfranchsisegeber in Amsterdam in den Niederlanden. Für Lizenznehmer wie den Bremerhavener Nacke, der bestenfalls über mangelhaftes Schulenglisch verfügt, wird es dadurch schwierig bis unmöglich, sein Anliegen selbst vorzutragen. Den Text für Briefe und Faxe klaubt er sich meist nicht sonderlich erfolgreich mit dem Wörterbuch zusammen, was Zeit und Nerven kostet.
Eine funktionsfähige Deutschland-Zentrale, die vieles vereinfachen würde, ist auch nach neun Jahren Subway in Good Old Germany nur in Ansätzen zu erkennen. Das Controlling liegt, anders als bei anderen Fastfood-Ketten, nicht in einer Hand, sondern ist verteilt auf 16 Gebietsleiter. Deutschland-Chef Wild kommt in seinem Büro in Köln gerade mal mit 15 Mitarbeitern aus. Die Restaurantbetreiber müssen die Verträge mit dem Unterfranchisegeber in Amsterdam schließen, kontrolliert werden sie dagegen von den Gebietsleitern in Deutschland. Eine übergeordnete Stelle hierzulande, die mit Informationen, Analysen und Ratschlägen bereitsteht, fehlt. Einen Betriebsrat, der für die Billigkräfte an der Verkaufstheke da wäre, gibt es erst recht nicht.
Ganz spurlos ging der Frust der Franchisenehmer an Subway nicht vorbei. 2006 verkündete das Unternehmen noch, bis 2010 in Deutschland McDonald’s zu überholen und 1500 Filialen zu betreiben. Inzwischen hat Deutschland-Chef Wild den Zeitpunkt auf das Jahr 2011 verschoben. Da eine Subway-Bude nur rund ein Drittel so viel wie ein McDonald’s-Restaurant umsetzt, beobachtet der Hamburger-Bräter den Angriff seiner Landsleute, so die offizielle Sprachregelung, „sehr gelassen“.
Weniger gelassen blickt Subway-Lizenznehmer Nacke in die Zukunft. Er sitzt auf 50.000 Euro Schulden und glaubt nicht, dass er noch lange seinen rebellischen Kurs gegen Subway durchhalten kann. Am 11. Dezember 2007 erstritt er vor dem Landgericht Hamburg zwar eine einstweilige Verfügung, derzufolge Subway Lieferanten nicht weiter dazu aufrufen darf, ihn zu boykottieren. Eine Einigung scheint jedoch außer Reichweite. Von Subway, sagt Nacke, erhoffe er „sich überhaupt nichts mehr“.