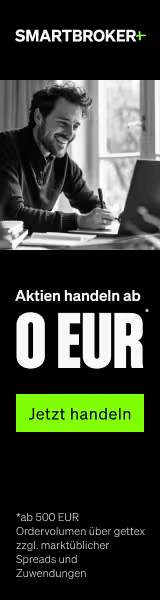App installieren
How to install the app on iOS
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Artikel und Diskussionen zu Wirtschaftsprognosen & Wirtschaftlichen Zusammenhängen
- Ersteller müh
- Erstellt am
- Tagged users Kein(e)
GfK-Studie: Kaufkraft in Deutschland stagniert 2009 - Die Welt
BERLIN (Dow Jones)--Die Kaufkraft in Deutschland wird einer Studie zufolge im nächsten Jahr stagnieren. Die Deutschen könnten 2009 pro Kopf durchschnittlich 18.946 EUR für Lebensunterhalt und Konsum ausgeben, berichtete die Tageszeitung "Die Welt" (Dienstagausgabe) unter Berufung auf eine Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). Das sind nur 210 EUR pro Person mehr als 2008 und entspricht einer Steigerung von rund 1,1%. Die voraussichtliche Inflationsquote liege jedoch ebenfalls bei rund 1%. Damit werde der Anstieg des privaten Wohlstands durch die prognostizierte Teuerung praktisch aufgezehrt.
Für dieses Jahr hatte die GfK noch ein Kaufkraftwachstum von 3,8% festgestellt und damit ein Plus, das spürbar über der Inflationsquote liegt. "Ob die einzelnen Menschen 2009 unterm Strich mehr oder weniger haben werden, hängt davon ab, ob sie individuell an den wachsenden Nettolöhnen in einigen Branchen profitieren oder beispielsweise durch Zeitarbeit gar Stellenverlust in anderen Branchen reale Einbußen hinnehmen müssen", sagte Simone Baecker-Neuchl, die Projektleiterin der GfK-Studie, der Zeitung.
BERLIN (Dow Jones)--Die Kaufkraft in Deutschland wird einer Studie zufolge im nächsten Jahr stagnieren. Die Deutschen könnten 2009 pro Kopf durchschnittlich 18.946 EUR für Lebensunterhalt und Konsum ausgeben, berichtete die Tageszeitung "Die Welt" (Dienstagausgabe) unter Berufung auf eine Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). Das sind nur 210 EUR pro Person mehr als 2008 und entspricht einer Steigerung von rund 1,1%. Die voraussichtliche Inflationsquote liege jedoch ebenfalls bei rund 1%. Damit werde der Anstieg des privaten Wohlstands durch die prognostizierte Teuerung praktisch aufgezehrt.
Für dieses Jahr hatte die GfK noch ein Kaufkraftwachstum von 3,8% festgestellt und damit ein Plus, das spürbar über der Inflationsquote liegt. "Ob die einzelnen Menschen 2009 unterm Strich mehr oder weniger haben werden, hängt davon ab, ob sie individuell an den wachsenden Nettolöhnen in einigen Branchen profitieren oder beispielsweise durch Zeitarbeit gar Stellenverlust in anderen Branchen reale Einbußen hinnehmen müssen", sagte Simone Baecker-Neuchl, die Projektleiterin der GfK-Studie, der Zeitung.
Top-Manager kündigen massive Sparprogramme und Personalabbau an
Der Konjunkturpessimismus der deutschen Führungsspitzen ist so ausgeprägt wie noch nie, sie rechnen erst 2010 oder später mit einem Ende der Talfahrt. Die Große Koalition bekommt gute Noten, vor allem Finanzminister Steinbrück sei beim Krisenmanagement dominierender als Kanzlerin Merkel.
In Deutschlands Unternehmen stehen drastische Sparmaßnahmen und Stellenstreichungen bevor. Das geht aus einer aktuellen Umfrage unter 609 repräsentativ ausgewählten Führungsspitzen aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung hervor, die das Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) für das Wirtschaftsmagazin Capital (Ausgabe 01/2009) regelmäßig durchführt. Rund zwei Drittel (63 Prozent) der befragten Top-Manager berichten demnach von bereits beschlossenen oder geplanten Sparprogrammen in ihren Betrieben. 37 Prozent sagen, dass es in ihren Unternehmen "Pläne gibt, Personal abzubauen".
Zudem befürwortet knapp die Hälfte (47 Prozent) "vorsorglich massive Sparprogramme". 72 Prozent fürchten, dass es erst 2010 oder später "mit der Wirtschaft wieder aufwärts" geht. Lediglich zwei Prozent rechnen im nächsten halben Jahr mit Besserung. "Der Konjunkturpessimismus der Führungsspitzen ist so ausgeprägt wie noch nie in zwei Jahrzehnten Elite-Panel", resümiert Allensbach-Chefin Renate Köcher.
Trotz der überwiegend pessimistischen Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist eine knappe Mehrheit (58 Prozent) der befragten Top-Manager der Meinung, "dass die deutsche Wirtschaft die Rezession gut bewältigen wird". Gut ein Drittel (37 Prozent) befürchtet dagegen einen „nachhaltigen Schaden“ für die Wirtschaft. "Die meisten Unternehmen haben ihre Hausaufgaben gemacht", äußerte Bayer-Vorstandschef Werner Wenning gegenüber Capital. 91 Prozent der Führungs-Elite erwartet zudem, "dass die Krise auch eine heilsame Wirkung" haben wird. "Ich hoffe, dass ein neuer Realismus einzieht", sagte Münchener-Rück-Vorstandschef Nikolaus von Bomhard. "Bei Eigenkapitalrenditen von 25 Prozent ist den Investoren aus den Augen geraten, dass dafür erhebliche Risiken in Kauf genommen werden mussten."
Große Mehrheit lobt Bundesregierung für Reaktion auf die Finanzkrise
Gute Noten geben die Top-Entscheider der Bundesregierung: 59 Prozent finden sie "stark genug" – einen besseren Wert erzielte diese bei der im "Capital-Elite-Panel" regelmäßig erhobenen Frage in den vergangenen 15 Jahren nur drei Mal. Mehr als vier von fünf Befragten (84 Prozent) sind der Meinung, dass "die Bundesregierung richtig auf die Finanzkrise reagiert hat". Sogar 93 Prozent der Führungskräfte bescheinigen der Großen Koalition, dass das Rettungspaket für die Banken "eine richtige Maßnahme" war. "Wie der Rettungsschirm über Parteigrenzen hinweg in Rekordzeit organisiert wurde, verdient allerhöchsten Respekt", sagte Telekom-Chef René Obermann zu Capital. Das kürzlich beschlossene erste Konjunkturpaket findet allerdings nicht ungeteilte Zustimmung: 43 Prozent sind der Ansicht, es hätte "umfangreicher ausfallen müssen". Fast zwei Drittel (62 Prozent) der Spitzenmanager hätten lieber eine Steuersenkung gesehen.
Angela Merkel ist für 80 Prozent eine „starke Kanzlerin“
Das insgesamt positive Urteil über die Große Koalition schlägt sich auch bei der Bewertung der handelnden Personen nieder: Angela Merkel halten 80 Prozent für eine "starke Kanzlerin" – der zweitbeste Wert seit ihrem Amtsantritt. Allerdings läuft ihr Peer Steinbrück derzeit den Rang ab: 45 Prozent der Führungskräfte in der Wirtschaft sehen in ihm "die dominierende Person beim Krisenmanagement" – von Merkel sagen das lediglich 32 Prozent. Unter den befragten Spitzenpolitikern kommen beide auf einen Wert von 42 Prozent. Verlierer im aktuellen "Capital-Elite-Panel" ist SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier: Ihm bescheinigen nur noch 59 Prozent aller Befragten, er habe "das Zeug, Bundeskanzler zu werden". Im Sommer waren es noch 70 Prozent.
Das "Capital-Elite-Panel" ist Europas exklusivste Führungskräfte-Umfrage, die das Institut für Demoskopie Allensbach für das Wirtschaftsmagazin Capital seit mehr als 20 Jahren bei Führungskräften aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung dreimal im Jahr durchführt. Unter den 609 Befragten sind 429 Spitzenkräfte aus der Wirtschaft, darunter 69 Vorstände oder Geschäftsführer von Unternehmen mit mehr als 20.000 Mitarbeitern, außerdem 124 Spitzenpolitiker, davon 31 Ministerpräsidenten und Minister, sowie die Leiter von 28 Bundesbehörden. Die Befragung lief vom 19. November bis 5. Dezember 2008.
von Henning Baethge, Rainer Hübner
http://www.capital.de/unternehmen/100018084.html
Der Konjunkturpessimismus der deutschen Führungsspitzen ist so ausgeprägt wie noch nie, sie rechnen erst 2010 oder später mit einem Ende der Talfahrt. Die Große Koalition bekommt gute Noten, vor allem Finanzminister Steinbrück sei beim Krisenmanagement dominierender als Kanzlerin Merkel.
In Deutschlands Unternehmen stehen drastische Sparmaßnahmen und Stellenstreichungen bevor. Das geht aus einer aktuellen Umfrage unter 609 repräsentativ ausgewählten Führungsspitzen aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung hervor, die das Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) für das Wirtschaftsmagazin Capital (Ausgabe 01/2009) regelmäßig durchführt. Rund zwei Drittel (63 Prozent) der befragten Top-Manager berichten demnach von bereits beschlossenen oder geplanten Sparprogrammen in ihren Betrieben. 37 Prozent sagen, dass es in ihren Unternehmen "Pläne gibt, Personal abzubauen".
Zudem befürwortet knapp die Hälfte (47 Prozent) "vorsorglich massive Sparprogramme". 72 Prozent fürchten, dass es erst 2010 oder später "mit der Wirtschaft wieder aufwärts" geht. Lediglich zwei Prozent rechnen im nächsten halben Jahr mit Besserung. "Der Konjunkturpessimismus der Führungsspitzen ist so ausgeprägt wie noch nie in zwei Jahrzehnten Elite-Panel", resümiert Allensbach-Chefin Renate Köcher.
Trotz der überwiegend pessimistischen Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist eine knappe Mehrheit (58 Prozent) der befragten Top-Manager der Meinung, "dass die deutsche Wirtschaft die Rezession gut bewältigen wird". Gut ein Drittel (37 Prozent) befürchtet dagegen einen „nachhaltigen Schaden“ für die Wirtschaft. "Die meisten Unternehmen haben ihre Hausaufgaben gemacht", äußerte Bayer-Vorstandschef Werner Wenning gegenüber Capital. 91 Prozent der Führungs-Elite erwartet zudem, "dass die Krise auch eine heilsame Wirkung" haben wird. "Ich hoffe, dass ein neuer Realismus einzieht", sagte Münchener-Rück-Vorstandschef Nikolaus von Bomhard. "Bei Eigenkapitalrenditen von 25 Prozent ist den Investoren aus den Augen geraten, dass dafür erhebliche Risiken in Kauf genommen werden mussten."
Große Mehrheit lobt Bundesregierung für Reaktion auf die Finanzkrise
Gute Noten geben die Top-Entscheider der Bundesregierung: 59 Prozent finden sie "stark genug" – einen besseren Wert erzielte diese bei der im "Capital-Elite-Panel" regelmäßig erhobenen Frage in den vergangenen 15 Jahren nur drei Mal. Mehr als vier von fünf Befragten (84 Prozent) sind der Meinung, dass "die Bundesregierung richtig auf die Finanzkrise reagiert hat". Sogar 93 Prozent der Führungskräfte bescheinigen der Großen Koalition, dass das Rettungspaket für die Banken "eine richtige Maßnahme" war. "Wie der Rettungsschirm über Parteigrenzen hinweg in Rekordzeit organisiert wurde, verdient allerhöchsten Respekt", sagte Telekom-Chef René Obermann zu Capital. Das kürzlich beschlossene erste Konjunkturpaket findet allerdings nicht ungeteilte Zustimmung: 43 Prozent sind der Ansicht, es hätte "umfangreicher ausfallen müssen". Fast zwei Drittel (62 Prozent) der Spitzenmanager hätten lieber eine Steuersenkung gesehen.
Angela Merkel ist für 80 Prozent eine „starke Kanzlerin“
Das insgesamt positive Urteil über die Große Koalition schlägt sich auch bei der Bewertung der handelnden Personen nieder: Angela Merkel halten 80 Prozent für eine "starke Kanzlerin" – der zweitbeste Wert seit ihrem Amtsantritt. Allerdings läuft ihr Peer Steinbrück derzeit den Rang ab: 45 Prozent der Führungskräfte in der Wirtschaft sehen in ihm "die dominierende Person beim Krisenmanagement" – von Merkel sagen das lediglich 32 Prozent. Unter den befragten Spitzenpolitikern kommen beide auf einen Wert von 42 Prozent. Verlierer im aktuellen "Capital-Elite-Panel" ist SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier: Ihm bescheinigen nur noch 59 Prozent aller Befragten, er habe "das Zeug, Bundeskanzler zu werden". Im Sommer waren es noch 70 Prozent.
Das "Capital-Elite-Panel" ist Europas exklusivste Führungskräfte-Umfrage, die das Institut für Demoskopie Allensbach für das Wirtschaftsmagazin Capital seit mehr als 20 Jahren bei Führungskräften aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung dreimal im Jahr durchführt. Unter den 609 Befragten sind 429 Spitzenkräfte aus der Wirtschaft, darunter 69 Vorstände oder Geschäftsführer von Unternehmen mit mehr als 20.000 Mitarbeitern, außerdem 124 Spitzenpolitiker, davon 31 Ministerpräsidenten und Minister, sowie die Leiter von 28 Bundesbehörden. Die Befragung lief vom 19. November bis 5. Dezember 2008.
von Henning Baethge, Rainer Hübner
http://www.capital.de/unternehmen/100018084.html
Gasstreit erreicht Wirtschaft
Conti geht das Gas aus
Dem Autozulieferer Continental drohen nach eigenen Angaben wegen Gasknappheit schon bald Produktionskürzungen und -stillstände. "Bei Continental sind einzelne Standorte in Osteuropa vom Stopp der Gaslieferungen betroffen", sagte eine Firmensprecherin auf Anfrage.
"Wir prüfen derzeit die Auswirkungen, unter Umständen wird die Produktion bereits kurzfristig beeinträchtigt. Auch ein teilweiser Produktionsstillstand ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht auszuschließen", sagte sie. Inwieweit und wann das die Belieferung der Kunden negativ beeinflusse, lasse sich derzeit noch nicht absehen.
Am Mittwochmorgen hatten die staatliche ukrainische Gasgesellschaft Naftogaz und der russische Gasmonopolist Gazprom übereinstimmend mitgeteilt, dass die Lieferungen von russischem Erdgas über die Ukraine nach Europa komplett gestoppt worden sind. Es fließe kein für europäische Kunden bestimmtes russisches Gas mehr durch die Pipelines in der Ukraine, hieß es. Von dem Lieferstopp sind vor allem mittel- und südost-europäische Staaten betroffen. Westeuropa bezieht derzeit über alternative Leitungen Erdgas.
http://www.n-tv.de/1081477.html
Conti geht das Gas aus
Dem Autozulieferer Continental drohen nach eigenen Angaben wegen Gasknappheit schon bald Produktionskürzungen und -stillstände. "Bei Continental sind einzelne Standorte in Osteuropa vom Stopp der Gaslieferungen betroffen", sagte eine Firmensprecherin auf Anfrage.
"Wir prüfen derzeit die Auswirkungen, unter Umständen wird die Produktion bereits kurzfristig beeinträchtigt. Auch ein teilweiser Produktionsstillstand ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht auszuschließen", sagte sie. Inwieweit und wann das die Belieferung der Kunden negativ beeinflusse, lasse sich derzeit noch nicht absehen.
Am Mittwochmorgen hatten die staatliche ukrainische Gasgesellschaft Naftogaz und der russische Gasmonopolist Gazprom übereinstimmend mitgeteilt, dass die Lieferungen von russischem Erdgas über die Ukraine nach Europa komplett gestoppt worden sind. Es fließe kein für europäische Kunden bestimmtes russisches Gas mehr durch die Pipelines in der Ukraine, hieß es. Von dem Lieferstopp sind vor allem mittel- und südost-europäische Staaten betroffen. Westeuropa bezieht derzeit über alternative Leitungen Erdgas.
http://www.n-tv.de/1081477.html
Muffensausen in Zuffenhausen
Porsche vor harten Zeiten
Der erfolgsverwöhnte Autobauer Porsche stimmt seine Belegschaft angesichts der schwachen Nachfrage auf schwere Zeiten ein. Nach einem Bericht der "Automobilwoche" kündigte der Chef des Sportwagenherstellers, Wendelin Wiedeking, erneut "einschneidende Maßnahmen" und eine Produktionskürzung an. "Vor uns liegt ein steiniger Weg, von dem wir noch nicht wissen, wie lang er sein wird", zitiert die Wirtschaftszeitung aus einem Brief Wiedekings an die Mitarbeiter.
Von den beschlossenen und in Teilen bereits angekündigten Maßnahmen seien sämtliche Unternehmensbereiche und Abteilungen betroffen. Vor allem bei den Kosten sieht Wiedeking "noch erhebliches Sparpotenzial, das wir heben wollen". Außerdem werde die Produktion gedrosselt. "Denn lieber bauen wir ein Fahrzeug zu wenig als eines zu viel, das dann auf der Halde landet und unser Unternehmen langfristig belastet", schreibt der Konzernchef laut "Automobilwoche" weiter.
In dem Brief zeigt sich der Porsche-Chef optimistisch, mit der Markteinführung der vierten Porsche-Baureihe Panamera im Spätsommer den Absatz stabilisieren zu können. Er kündigt aber auch an: "Keine Frage, wir werden unseren Mitarbeitern in den kommenden Monaten viel abverlangen. Und wir alle werden unsere Gürtel etwas enger schnallen müssen." Für Porsche sei dies eine ungewohnte Erfahrung.
Auch Porsche war zuletzt von der schweren Absatzkrise auf dem Automarkt eingeholt worden. Der Stuttgarter Autohersteller erwartet einen "spürbaren Absatzrückgang" im laufenden Geschäftsjahr und hat ein Sparprogramm gestartet. Der Start ins neue Geschäftsjahr 2008/09 war ernüchternd. Von Anfang August bis Ende November sank der Umsatz von 2,36 Milliarden Euro im Vorjahr auf nur noch leicht über 2 Milliarden Euro, der Absatz ging um 5500 auf 25 200 Sport- und Geländewagen zurück.
http://www.n-tv.de/1082927.html
Porsche vor harten Zeiten
Der erfolgsverwöhnte Autobauer Porsche stimmt seine Belegschaft angesichts der schwachen Nachfrage auf schwere Zeiten ein. Nach einem Bericht der "Automobilwoche" kündigte der Chef des Sportwagenherstellers, Wendelin Wiedeking, erneut "einschneidende Maßnahmen" und eine Produktionskürzung an. "Vor uns liegt ein steiniger Weg, von dem wir noch nicht wissen, wie lang er sein wird", zitiert die Wirtschaftszeitung aus einem Brief Wiedekings an die Mitarbeiter.
Von den beschlossenen und in Teilen bereits angekündigten Maßnahmen seien sämtliche Unternehmensbereiche und Abteilungen betroffen. Vor allem bei den Kosten sieht Wiedeking "noch erhebliches Sparpotenzial, das wir heben wollen". Außerdem werde die Produktion gedrosselt. "Denn lieber bauen wir ein Fahrzeug zu wenig als eines zu viel, das dann auf der Halde landet und unser Unternehmen langfristig belastet", schreibt der Konzernchef laut "Automobilwoche" weiter.
In dem Brief zeigt sich der Porsche-Chef optimistisch, mit der Markteinführung der vierten Porsche-Baureihe Panamera im Spätsommer den Absatz stabilisieren zu können. Er kündigt aber auch an: "Keine Frage, wir werden unseren Mitarbeitern in den kommenden Monaten viel abverlangen. Und wir alle werden unsere Gürtel etwas enger schnallen müssen." Für Porsche sei dies eine ungewohnte Erfahrung.
Auch Porsche war zuletzt von der schweren Absatzkrise auf dem Automarkt eingeholt worden. Der Stuttgarter Autohersteller erwartet einen "spürbaren Absatzrückgang" im laufenden Geschäftsjahr und hat ein Sparprogramm gestartet. Der Start ins neue Geschäftsjahr 2008/09 war ernüchternd. Von Anfang August bis Ende November sank der Umsatz von 2,36 Milliarden Euro im Vorjahr auf nur noch leicht über 2 Milliarden Euro, der Absatz ging um 5500 auf 25 200 Sport- und Geländewagen zurück.
http://www.n-tv.de/1082927.html
Enttäuschungen in der Berichtssaison vorprogrammiert
FRANKFURT (Dow Jones)--Für die anstehende Berichtssaison zum vierten Quartal gehen Aktienstrategen davon aus, dass die ohnehin pessimistischen Erwartungen der Analysten sogar noch unterboten werden. Andreas Hürkampf von der Commerzbank schätzt, dass sich in den Konsenserwartungen derzeit ein Gewinnrückgang vom Zyklushoch von 20% bis 25% widerspiegele. Vor dem Hintergrund von Gewinneinbrüchen von 50% bis 60% in den vergangenen Rezessionen sei daher ein weiterer Abschlag auf die Prognosen von 25% bis 30% nötig.
"Eine Reihe von Unternehmen wird wohl für das vergangene Quartal sogar Verluste ausweisen, was für einige Analysten eine Überraschung sein dürfte", sagt Hürkampf. Entsprechend sieht er den DAX weiter bis auf 4.400 Punkte zurückfallen. Das Jahrestief 2008 bei gut 4.000 Punkten wird seiner Ansicht nach aber nicht mehr unterschritten. Die Preis-Buchwert-Verhältnisse vieler Aktien befänden sich bereits auf Allzeittiefs - noch niedrigere Bewertungen sind seiner Meinung nach nicht zu rechtfertigen.
Auch für Tammo Greetfeld, Aktienstratege bei der UniCredit, sind die derzeitigen Gewinnschätzungen für 2009 noch zu hoch. Er hält weitere Abwärtsrevisionen um 20% für möglich. Dennoch glaubt er, dass die Aktienmärkte die jüngste Tendenz einer Stabilisierung und leichten Aufwärtsentwicklung beibehalten.
Er begründet dies damit, dass Prognoserevisionen kurzfristig zwar belastend wirkten, aber nur die eine Seite der Medaille darstellten. Ihnen gegenüber stünden die breit gestreuten Maßnahmen der Zentralbanken und Regierungen zur Stabilisierung der Finanzmärkte sowie zur Stimulierung der Konjunktur. Diese Maßnahmen und ihre Auswirkungen seien mittelfristig entscheidender für die Kursentwicklung, womit die UniCredit auch ihr optimistisches Halbjahresziel für den DAX von 5.300 Punkten begründet.
Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) geht ebenfalls weiter von einem Übergewicht negativer Nachrichten aus. "Trotz der bisherigen Erwartungsrevisionen auf Makro- und Mikroebene sollte daraus auch auf die Aktienmärkte noch weiterer Druck resultieren und ein Test der Region um 4.500 Punkte im DAX erscheint durchaus möglich", so Analyst Steffen Neumann.
FRANKFURT (Dow Jones)--Für die anstehende Berichtssaison zum vierten Quartal gehen Aktienstrategen davon aus, dass die ohnehin pessimistischen Erwartungen der Analysten sogar noch unterboten werden. Andreas Hürkampf von der Commerzbank schätzt, dass sich in den Konsenserwartungen derzeit ein Gewinnrückgang vom Zyklushoch von 20% bis 25% widerspiegele. Vor dem Hintergrund von Gewinneinbrüchen von 50% bis 60% in den vergangenen Rezessionen sei daher ein weiterer Abschlag auf die Prognosen von 25% bis 30% nötig.
"Eine Reihe von Unternehmen wird wohl für das vergangene Quartal sogar Verluste ausweisen, was für einige Analysten eine Überraschung sein dürfte", sagt Hürkampf. Entsprechend sieht er den DAX weiter bis auf 4.400 Punkte zurückfallen. Das Jahrestief 2008 bei gut 4.000 Punkten wird seiner Ansicht nach aber nicht mehr unterschritten. Die Preis-Buchwert-Verhältnisse vieler Aktien befänden sich bereits auf Allzeittiefs - noch niedrigere Bewertungen sind seiner Meinung nach nicht zu rechtfertigen.
Auch für Tammo Greetfeld, Aktienstratege bei der UniCredit, sind die derzeitigen Gewinnschätzungen für 2009 noch zu hoch. Er hält weitere Abwärtsrevisionen um 20% für möglich. Dennoch glaubt er, dass die Aktienmärkte die jüngste Tendenz einer Stabilisierung und leichten Aufwärtsentwicklung beibehalten.
Er begründet dies damit, dass Prognoserevisionen kurzfristig zwar belastend wirkten, aber nur die eine Seite der Medaille darstellten. Ihnen gegenüber stünden die breit gestreuten Maßnahmen der Zentralbanken und Regierungen zur Stabilisierung der Finanzmärkte sowie zur Stimulierung der Konjunktur. Diese Maßnahmen und ihre Auswirkungen seien mittelfristig entscheidender für die Kursentwicklung, womit die UniCredit auch ihr optimistisches Halbjahresziel für den DAX von 5.300 Punkten begründet.
Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) geht ebenfalls weiter von einem Übergewicht negativer Nachrichten aus. "Trotz der bisherigen Erwartungsrevisionen auf Makro- und Mikroebene sollte daraus auch auf die Aktienmärkte noch weiterer Druck resultieren und ein Test der Region um 4.500 Punkte im DAX erscheint durchaus möglich", so Analyst Steffen Neumann.
Chinesen als Käufer
Thyssen verkauft Transrapid-Technik
von Andreas Hoffbauer und Eberhard Krummheuer
Der Industriekonzern Thyssen-Krupp setzt nach dem Scheitern des Transrapid-Projektes in München auf die seit langem angestrebte Verlängerung der weltweit einzigen kommerziellen Magnetbahnstrecke in Schanghai. Um dies den Chinesen schmackhaft zu machen, will der Konzern Teile seiner Magnetschwebetechnologie an China verkaufen.
PEKING/DÜSSELDORF. Eine entsprechende Vereinbarung soll kommende Woche beim Berlin-Besuch des chinesischen Premiers Wen Jiabao unterzeichnet werden, erfuhr das Handelsblatt aus industrienahen Kreisen. Unklar ist jedoch, wie weit der Know-how-Transfer geht. Eine Thyssen-Sprecherin betonte, der Konzern glaube weiter an die Magnetschwebe-Technik: "Die Kerntechnologie bleibt bei uns." Aus Kreisen der Beteiligten am geplatzten Münchener Projekt hieß es allerdings, Thyssen-Krupp habe kein Interesse mehr am Transrapid und wolle tendenziell alles verkaufen.
Das Bundesverkehrsministerium teilte auf Anfrage mit, dass der Bund als Förderer der Transrapid-Technologie nicht nur ein Mitspracherecht bei der Veräußerung habe, sondern auch an den Einnahmen des LizenzVerkaufs beteiligt werden müsste. Eine Sprecherin erklärte, der Bund habe einen Anspruch auf bis zu 100 Mio. Euro Rückzahlung für seine aus Steuergeldern geleistete Entwicklungshilfe für die Magnetbahn.
Transrapid-Partner Siemens hat dagegen keine Verkaufsabsichten. Während Thyssen die eigentliche Magnetschwebetechnik beisteuert, liefert der Münchner Konzern für den Transrapid die Stromversorgung in der Strecke und die komplette Leit- und Sicherungstechnik. "Unser vordringliches Ziel war und bleibt, die Kernkompetenzen der Transrapid-Technologie bei Siemens zu erhalten", erklärte ein Sprecher. Bahntechnik-Experten begründen das damit, dass die Siemens-Technologie prinzipiell identisch ist mit den Steuerungs- und Überwachungssystemen für Hochgeschwindigkeitsbahnen wie dem ICE. Da lasse sich Siemens nicht in die Karten schauen.
Allerdings setzt auch Siemens auf einen positiven Schub durch den Besuch des chinesischen Premiers in Berlin. Das Projekt in Schanghai sei "von strategischer Bedeutung für die weitere Vermarktung", so Siemens gestern. "Wenn hier der Durchbruch gelingt, eröffnen sich aus unserer Sicht weitere Möglichkeiten auch in anderen Regionen", hieß es.
In Schanghai hatte Oberbürgermeister Han Zheng am Wochenende erklärt, die Verlängerung der seit fünf Jahren bestehenden Transrapid-Strecke vom Flughafen Pudong in Richtung Innenstadt sei nun wieder Teil der städtischen Verkehrsplanung. Die Metropole plant eine 32 Kilometer lange Verbindung zwischen den beiden großen Flughäfen Hongqiao und Pudong.
Für die Verlängerung in Schanghai und eine Weiterführung in die 160 Kilometer entfernte Stadt Hangzhou waren Ende 2006 Verträge zwischen Thyssen/Siemens und dem chinesischen Kunden unterzeichnet worden, die aber erst nach der Genehmigung durch die chinesische Regierung in Kraft treten können.
Doch auch in China spielen inzwischen Kosten und Bürgereinwände zunehmend eine Rolle. Selten hat ein Infrastrukturprojekt so viel Widerstand in China bekommen. Der Transrapid-Plan von Schanghai gehört so auch nicht zum Krisen-Konjunkturpaket, das Peking im November verkündet hat. Nun soll aber der Technologie-Deal die letzten Hürden beseitigen. Denkbar ist eine Lizenzvergabe, die auch die 220 Transrapid-Arbeitsplätze im hessischen Kassel erhalten könnte. Thyssen hofft auf einen dreistelligen Millionenbetrag aus dem Lizenzverkauf.
Bisher haben die Chinesen laut Presseberichten über eine Lizenz nur Zugriff auf die Waggons. Käme es zu einem Verkauf der Schwebetechnologie, könnten die Chinesen die Magnetbahn selbst bauen. China verfüge bereits über eine Transrapid-Teststrecke und die Grundlagen für das Verkehrssystem, hat der Vizedirektor des Eisenbahn-Instituts der Shanghaier Tongji-Universität, Xie Weida, bestätigt. Bislang sei der Zukauf der Magnetbahn-Kerntechnologie aber am hohen Preis gescheitert.
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/thyssen-verkauft-transrapid-technik;2130470
Thyssen verkauft Transrapid-Technik
von Andreas Hoffbauer und Eberhard Krummheuer
Der Industriekonzern Thyssen-Krupp setzt nach dem Scheitern des Transrapid-Projektes in München auf die seit langem angestrebte Verlängerung der weltweit einzigen kommerziellen Magnetbahnstrecke in Schanghai. Um dies den Chinesen schmackhaft zu machen, will der Konzern Teile seiner Magnetschwebetechnologie an China verkaufen.
PEKING/DÜSSELDORF. Eine entsprechende Vereinbarung soll kommende Woche beim Berlin-Besuch des chinesischen Premiers Wen Jiabao unterzeichnet werden, erfuhr das Handelsblatt aus industrienahen Kreisen. Unklar ist jedoch, wie weit der Know-how-Transfer geht. Eine Thyssen-Sprecherin betonte, der Konzern glaube weiter an die Magnetschwebe-Technik: "Die Kerntechnologie bleibt bei uns." Aus Kreisen der Beteiligten am geplatzten Münchener Projekt hieß es allerdings, Thyssen-Krupp habe kein Interesse mehr am Transrapid und wolle tendenziell alles verkaufen.
Das Bundesverkehrsministerium teilte auf Anfrage mit, dass der Bund als Förderer der Transrapid-Technologie nicht nur ein Mitspracherecht bei der Veräußerung habe, sondern auch an den Einnahmen des LizenzVerkaufs beteiligt werden müsste. Eine Sprecherin erklärte, der Bund habe einen Anspruch auf bis zu 100 Mio. Euro Rückzahlung für seine aus Steuergeldern geleistete Entwicklungshilfe für die Magnetbahn.
Transrapid-Partner Siemens hat dagegen keine Verkaufsabsichten. Während Thyssen die eigentliche Magnetschwebetechnik beisteuert, liefert der Münchner Konzern für den Transrapid die Stromversorgung in der Strecke und die komplette Leit- und Sicherungstechnik. "Unser vordringliches Ziel war und bleibt, die Kernkompetenzen der Transrapid-Technologie bei Siemens zu erhalten", erklärte ein Sprecher. Bahntechnik-Experten begründen das damit, dass die Siemens-Technologie prinzipiell identisch ist mit den Steuerungs- und Überwachungssystemen für Hochgeschwindigkeitsbahnen wie dem ICE. Da lasse sich Siemens nicht in die Karten schauen.
Allerdings setzt auch Siemens auf einen positiven Schub durch den Besuch des chinesischen Premiers in Berlin. Das Projekt in Schanghai sei "von strategischer Bedeutung für die weitere Vermarktung", so Siemens gestern. "Wenn hier der Durchbruch gelingt, eröffnen sich aus unserer Sicht weitere Möglichkeiten auch in anderen Regionen", hieß es.
In Schanghai hatte Oberbürgermeister Han Zheng am Wochenende erklärt, die Verlängerung der seit fünf Jahren bestehenden Transrapid-Strecke vom Flughafen Pudong in Richtung Innenstadt sei nun wieder Teil der städtischen Verkehrsplanung. Die Metropole plant eine 32 Kilometer lange Verbindung zwischen den beiden großen Flughäfen Hongqiao und Pudong.
Für die Verlängerung in Schanghai und eine Weiterführung in die 160 Kilometer entfernte Stadt Hangzhou waren Ende 2006 Verträge zwischen Thyssen/Siemens und dem chinesischen Kunden unterzeichnet worden, die aber erst nach der Genehmigung durch die chinesische Regierung in Kraft treten können.
Doch auch in China spielen inzwischen Kosten und Bürgereinwände zunehmend eine Rolle. Selten hat ein Infrastrukturprojekt so viel Widerstand in China bekommen. Der Transrapid-Plan von Schanghai gehört so auch nicht zum Krisen-Konjunkturpaket, das Peking im November verkündet hat. Nun soll aber der Technologie-Deal die letzten Hürden beseitigen. Denkbar ist eine Lizenzvergabe, die auch die 220 Transrapid-Arbeitsplätze im hessischen Kassel erhalten könnte. Thyssen hofft auf einen dreistelligen Millionenbetrag aus dem Lizenzverkauf.
Bisher haben die Chinesen laut Presseberichten über eine Lizenz nur Zugriff auf die Waggons. Käme es zu einem Verkauf der Schwebetechnologie, könnten die Chinesen die Magnetbahn selbst bauen. China verfüge bereits über eine Transrapid-Teststrecke und die Grundlagen für das Verkehrssystem, hat der Vizedirektor des Eisenbahn-Instituts der Shanghaier Tongji-Universität, Xie Weida, bestätigt. Bislang sei der Zukauf der Magnetbahn-Kerntechnologie aber am hohen Preis gescheitert.
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/thyssen-verkauft-transrapid-technik;2130470
Gasnetz für 3,5 Mrd.
EU will ausbauen
Die EU-Kommission will einem Zeitungsbericht zufolge 3,5 Mrd. Euro in das europäische Energieleitungsnetz investieren. Damit ziehe die EU-Behörde Konsequenzen aus der russisch-ukrainischen Gaskrise. Ein entsprechendes Papier der Kommission solle in der kommenden Woche in Brüssel vorgestellt werden, schreibt das "Handelsblatt".
Die Kommission plant dem Bericht zufolge, die nationalen Leitungsnetze in der EU besser zu verbinden. Die Mitgliedstaaten müssten im Falle einer erneuten Versorgungskrise in der Lage sein, sich gegenseitig zu beliefern. Konkret geplant seien Investitionen in die Gas- und Stromverbindungen zwischen Skandinavien, Polen und dem Baltikum. Auch sollen die Leitungsnetze in Osteuropa besser verknüpft werden, vor allem zwischen Rumänien, der Slowakei, Österreich und Ungarn. Die Slowakei war von dem Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine besonders schwer getroffen worden.
Nach einer fast zweiwöchigen Unterbrechung hatte Russland die Gaslieferungen durch die Ukraine Anfang der Woche wieder aufgenommen. Am Mittwoch erreichte das russische Erdgas auch Deutschland wieder.
http://www.n-tv.de/1089711.html
EU will ausbauen
Die EU-Kommission will einem Zeitungsbericht zufolge 3,5 Mrd. Euro in das europäische Energieleitungsnetz investieren. Damit ziehe die EU-Behörde Konsequenzen aus der russisch-ukrainischen Gaskrise. Ein entsprechendes Papier der Kommission solle in der kommenden Woche in Brüssel vorgestellt werden, schreibt das "Handelsblatt".
Die Kommission plant dem Bericht zufolge, die nationalen Leitungsnetze in der EU besser zu verbinden. Die Mitgliedstaaten müssten im Falle einer erneuten Versorgungskrise in der Lage sein, sich gegenseitig zu beliefern. Konkret geplant seien Investitionen in die Gas- und Stromverbindungen zwischen Skandinavien, Polen und dem Baltikum. Auch sollen die Leitungsnetze in Osteuropa besser verknüpft werden, vor allem zwischen Rumänien, der Slowakei, Österreich und Ungarn. Die Slowakei war von dem Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine besonders schwer getroffen worden.
Nach einer fast zweiwöchigen Unterbrechung hatte Russland die Gaslieferungen durch die Ukraine Anfang der Woche wieder aufgenommen. Am Mittwoch erreichte das russische Erdgas auch Deutschland wieder.
http://www.n-tv.de/1089711.html
Moin 8)
gerade ist mir der Appetit vergangen ...
14. Januar 2009 - 12:40
Finanzkollaps steht vielleicht erst noch bevor
http://www.swissinfo.org/ger/wirtsc...ect=161&sid=10190157&cKey=1232608386000&ty=st

Professor Katzenstein: Die Schweiz hat wenig zu lachen.
Finanzsektor grösser als BSP
Trotz staatlichen Hilfspaketen könnte das globale Finanzsystem vor dem Abgrund stehen, warnt Peter Katzenstein. Der New Yorker Professor beurteilt die Schweiz als besonders verwundbar, sollten weitere Dollar-Billionenbeträge wertlos werden.
Die Schweiz sei wegen ihres Finanzplatzes verwundbarer als andere Länder, meinte Peter Katzenstein kürzlich an der Jahrestagung des Instituts für Politikwissenschaft der Universität St. Gallen.
Der Professor für internationale Studien an der Cornell Universität in New York beruft sich auf das grosse Gewicht, das der Finanzplatz in der Schweizer Wirtschaft einnimmt.
Zwar hätten Regierungen rund um die Welt in den letzen Monaten Billionen an Dollar in das Finanzsystem gepumpt, um die einzelnen Institutionen zu stützen, die "giftigen Assets" zu decken und den Banken die Zuversicht zurückzugeben, langsam wieder in den Geldmarkt zurückzukehren.
Es könnten noch Billionen anfallen
Allein die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Oktober mit einem Paket von 67 Mrd. Franken die grösste Bank des Landes, die UBS, mit zusätzlichen Mitteln unterstützt.
Die UBS dürfte zusammen mit Credit Suisse im Rahmen der Subprime-Krise rund 55 Mrd. Franken abgeschrieben haben - und dies könnte noch nicht alles gewesen sein.
Katzenstein warnte in St. Gallen, dass die bisher realisierten Verlustsummen klein erscheinen könnten gegenüber den mehr als 50 Billionen Dollar, die in Form von komplizierten Anlageformen in den letzten Jahren in die Finanzmärkte flossen.
Zwar könne die Summe dieser Anlagen einigermassen geschätzt werden, so Katzenstein. Aber aus der nicht regulierten Charakteristik der Finanzsysteme ergebe sich, dass niemand wirklich wisse, wie die Geld verteilt worden seien und wie hoch die Schulden seien, die daraus für die Finanzinstitutionen resultierten.
System-Kollaps
"Banken, auch jene in der Schweiz, halten eine gewisse Summe dieser Anlagen als Aktiven, wissen aber nicht, wie sie diese bewerten sollen", sagte Katzenstein gegenüber swissinfo.
"Wie soll ein globales Finanzsystem funktionieren, wenn man nicht weiss, wie hoch man die Aktiven bewerten soll?"
Katzenstein ist der Auffassung, es sei etwas gar optimitisch, bereits jetzt zu glauben, dass die Finanzbranche aus dem Gröbsten herausgefunden habe.
"Allgemein herrscht die Meinung vor, das Finanzsystem habe sich aufgefangen, weil sich der führende US-Börsenindex Dow Jones zwischen 8000 und 9000 Punkten eingependelt hat", so der US-Professor.
Doch der Dow Jones könnte bis auf 3000 Punkte fallen, "die Möglichkeit eines Systemkollapses besteht wirklich".
Finanzsektor grösser als BSP
Träte dieser Fall ein, fiele das Schweizer Finanzsystem zusammen und der Schweiz könnte ein ähnliches Schicksal blühen wie Island.
Dessen Währung war in der Folge der Finanzkrise zusammengefallen, und die drei exponierten Banken des Landes mussten im Oktober verstaatlicht werden.
Es würde schon genügen, wenn eine der Grossbanken den Geist aufgäbe. Solche Szenarien - einst noch unvorstellbar - seien heute möglich. Und das führe doch zu grosser Verunsicherung, so Katzenstein.
Die Schweiz sei einem Abschmelzen der Finanzsysteme besonders ausgesetzt, übertrifft die Summe der Aktiven der Schweizer Banken doch das Bruttonationalprodukt um das Neunfache!
Dieses Verhältnis sei grösser als in jedem anderen Land. Staat und Regierung wären deshalb nicht in der Lage, der Finanzbranche beizustehen, wenn ein substanzieller Teil dieser Bankaktiven obsolet würde.
Verteidigung des Systems
Der US-Professor lobte zwar das politische und wirtschaftliche System der Schweiz für seine Flexibilität, so beispielsweise als es um die Rettung der in Schwierigkeiten geratenen Uhrenbranche ging.
Doch inzwischen glaubt Katzenstein, dass die jüngsten Entwicklungen im Finanzsektor die Kapazitäten der Schweiz zur Verhinderung eines Zusammenbruchs übersteigen.
Er ist aber überzeugt, dass sich die Schweizer Politiker und Wirtschaftsführer der Gefahren bewusst sind und hart um eine Rettung kämpfen würden, sollte die Finanzbranche arg ins Schleudern kommen.
"Die Schweizer sind sich der Risiken wohl bewusst, weil das Land eine alte Banken-Tradition aufweist", so Katzenstein. "Sie würden auch den letzten Franken mobilisieren, um das System zu verteidigen."
swissinfo, Matthew Allen in St Gallen
(Übertragung aus dem Englischen: Alexander Künzle)
-------------------------------------------------
RISIKO-ABSICHERUNG
Das globale Finanzsystem hat eine Reihe von Methoden entwickelt, mit denen Institute ihre in den vergangenen Jahren gestiegenen Risiken absicherten.
Die gängigste Form heisst Credit Default Swap (CDS, Kredit-Derivat). Sie wurde zusammen mit den riskanten Anlagen, zum Beispiel den Subprime Hypotheken-Pfandbriefen verkauft.
Kaufte eine Bank solche Wertpapiere, schloss sie gleichzeitig mit einer anderen Bank einen CDS-Vertrag ab. Gegen eine Gebühr wurden die Ausfallrisiken übernommen.
Solche Instrumente nennt man "Risiko Swaps" statt Risiko-Policen. Damit liessen sich Vorschriften umgehen, die höhere Rückstellungen verlangt hätten, um im Verlustfall mehr Kapital zur Verfügung zu haben.
Diese Instrumente waren als "Hedging" (Gegenwette, Deckung) gegen Risiken erfunden worden. Sie wurden wieder populär, als man begann, sie auch zu handeln.
Man handelte sie als Wetten gegen Unternehmens-Insolvenzen.
Da diese CDS keiner Regulierung unterstehen, weiss niemand genau, wieviele solche Instrumente auf den Märkten ausgestellt wurden, wer sie herausgab und besitzt.
Schätzungen aus freiwilligen Daten beziffern die Summen auf rund 50 bis 55 Trillionen Franken. :shock:
gerade ist mir der Appetit vergangen ...
14. Januar 2009 - 12:40
Finanzkollaps steht vielleicht erst noch bevor
http://www.swissinfo.org/ger/wirtsc...ect=161&sid=10190157&cKey=1232608386000&ty=st

Professor Katzenstein: Die Schweiz hat wenig zu lachen.
Finanzsektor grösser als BSP
Trotz staatlichen Hilfspaketen könnte das globale Finanzsystem vor dem Abgrund stehen, warnt Peter Katzenstein. Der New Yorker Professor beurteilt die Schweiz als besonders verwundbar, sollten weitere Dollar-Billionenbeträge wertlos werden.
Die Schweiz sei wegen ihres Finanzplatzes verwundbarer als andere Länder, meinte Peter Katzenstein kürzlich an der Jahrestagung des Instituts für Politikwissenschaft der Universität St. Gallen.
Der Professor für internationale Studien an der Cornell Universität in New York beruft sich auf das grosse Gewicht, das der Finanzplatz in der Schweizer Wirtschaft einnimmt.
Zwar hätten Regierungen rund um die Welt in den letzen Monaten Billionen an Dollar in das Finanzsystem gepumpt, um die einzelnen Institutionen zu stützen, die "giftigen Assets" zu decken und den Banken die Zuversicht zurückzugeben, langsam wieder in den Geldmarkt zurückzukehren.
Es könnten noch Billionen anfallen
Allein die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Oktober mit einem Paket von 67 Mrd. Franken die grösste Bank des Landes, die UBS, mit zusätzlichen Mitteln unterstützt.
Die UBS dürfte zusammen mit Credit Suisse im Rahmen der Subprime-Krise rund 55 Mrd. Franken abgeschrieben haben - und dies könnte noch nicht alles gewesen sein.
Katzenstein warnte in St. Gallen, dass die bisher realisierten Verlustsummen klein erscheinen könnten gegenüber den mehr als 50 Billionen Dollar, die in Form von komplizierten Anlageformen in den letzten Jahren in die Finanzmärkte flossen.
Zwar könne die Summe dieser Anlagen einigermassen geschätzt werden, so Katzenstein. Aber aus der nicht regulierten Charakteristik der Finanzsysteme ergebe sich, dass niemand wirklich wisse, wie die Geld verteilt worden seien und wie hoch die Schulden seien, die daraus für die Finanzinstitutionen resultierten.
System-Kollaps
"Banken, auch jene in der Schweiz, halten eine gewisse Summe dieser Anlagen als Aktiven, wissen aber nicht, wie sie diese bewerten sollen", sagte Katzenstein gegenüber swissinfo.
"Wie soll ein globales Finanzsystem funktionieren, wenn man nicht weiss, wie hoch man die Aktiven bewerten soll?"
Katzenstein ist der Auffassung, es sei etwas gar optimitisch, bereits jetzt zu glauben, dass die Finanzbranche aus dem Gröbsten herausgefunden habe.
"Allgemein herrscht die Meinung vor, das Finanzsystem habe sich aufgefangen, weil sich der führende US-Börsenindex Dow Jones zwischen 8000 und 9000 Punkten eingependelt hat", so der US-Professor.
Doch der Dow Jones könnte bis auf 3000 Punkte fallen, "die Möglichkeit eines Systemkollapses besteht wirklich".
Finanzsektor grösser als BSP
Träte dieser Fall ein, fiele das Schweizer Finanzsystem zusammen und der Schweiz könnte ein ähnliches Schicksal blühen wie Island.
Dessen Währung war in der Folge der Finanzkrise zusammengefallen, und die drei exponierten Banken des Landes mussten im Oktober verstaatlicht werden.
Es würde schon genügen, wenn eine der Grossbanken den Geist aufgäbe. Solche Szenarien - einst noch unvorstellbar - seien heute möglich. Und das führe doch zu grosser Verunsicherung, so Katzenstein.
Die Schweiz sei einem Abschmelzen der Finanzsysteme besonders ausgesetzt, übertrifft die Summe der Aktiven der Schweizer Banken doch das Bruttonationalprodukt um das Neunfache!
Dieses Verhältnis sei grösser als in jedem anderen Land. Staat und Regierung wären deshalb nicht in der Lage, der Finanzbranche beizustehen, wenn ein substanzieller Teil dieser Bankaktiven obsolet würde.
Verteidigung des Systems
Der US-Professor lobte zwar das politische und wirtschaftliche System der Schweiz für seine Flexibilität, so beispielsweise als es um die Rettung der in Schwierigkeiten geratenen Uhrenbranche ging.
Doch inzwischen glaubt Katzenstein, dass die jüngsten Entwicklungen im Finanzsektor die Kapazitäten der Schweiz zur Verhinderung eines Zusammenbruchs übersteigen.
Er ist aber überzeugt, dass sich die Schweizer Politiker und Wirtschaftsführer der Gefahren bewusst sind und hart um eine Rettung kämpfen würden, sollte die Finanzbranche arg ins Schleudern kommen.
"Die Schweizer sind sich der Risiken wohl bewusst, weil das Land eine alte Banken-Tradition aufweist", so Katzenstein. "Sie würden auch den letzten Franken mobilisieren, um das System zu verteidigen."
swissinfo, Matthew Allen in St Gallen
(Übertragung aus dem Englischen: Alexander Künzle)
-------------------------------------------------
RISIKO-ABSICHERUNG
Das globale Finanzsystem hat eine Reihe von Methoden entwickelt, mit denen Institute ihre in den vergangenen Jahren gestiegenen Risiken absicherten.
Die gängigste Form heisst Credit Default Swap (CDS, Kredit-Derivat). Sie wurde zusammen mit den riskanten Anlagen, zum Beispiel den Subprime Hypotheken-Pfandbriefen verkauft.
Kaufte eine Bank solche Wertpapiere, schloss sie gleichzeitig mit einer anderen Bank einen CDS-Vertrag ab. Gegen eine Gebühr wurden die Ausfallrisiken übernommen.
Solche Instrumente nennt man "Risiko Swaps" statt Risiko-Policen. Damit liessen sich Vorschriften umgehen, die höhere Rückstellungen verlangt hätten, um im Verlustfall mehr Kapital zur Verfügung zu haben.
Diese Instrumente waren als "Hedging" (Gegenwette, Deckung) gegen Risiken erfunden worden. Sie wurden wieder populär, als man begann, sie auch zu handeln.
Man handelte sie als Wetten gegen Unternehmens-Insolvenzen.
Da diese CDS keiner Regulierung unterstehen, weiss niemand genau, wieviele solche Instrumente auf den Märkten ausgestellt wurden, wer sie herausgab und besitzt.
Schätzungen aus freiwilligen Daten beziffern die Summen auf rund 50 bis 55 Trillionen Franken. :shock:
21.01.2009
Frankfurter Gespräch des Handelsblatts
Charttechniker schlagen Alarm
DÜSSELDORF/FRANKFURT.
Nach dramatisch fallenden Kursen gleich zu Jahresbeginn erwarten die Analysten allenfalls kurzfristig eine Erholung. "Der Markt ist extrem überverkauft", sagt Michael Riesner von der Schweizer Großbank UBS. Technisch orientierte Analysten leiten aus dem Verlauf der Kurscharts Rückschlüsse auf die Zukunft ab.
Inmitten der schweren Baisse beim Platzen der Internetblase hatten viele Charttechniker 2001 und 2002 trotz stark gefallener Kurse vor einem Einstieg gewarnt. Seitdem orientieren sich auch in Europa viele Investoren am Verlauf der Charts. Eine Fülle von Computerprogrammen sind daraus ausgerichtet. In den USA genießt die Zunft seit den legendären Erfolgen des Börsenaltmeisters Jesse Livermore in der Panik von 1907 und der Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1932 hohes Ansehen.
Von einer ausgeprägten Baisse spricht Christian Henke von der WestLB: "Erholungen sind nur kurze Gegenbewegungen innerhalb eines intakten Abwärtstrends." Von einer Kehrtwende ließe sich erst dann sprechen, wenn der Dax die 5 300er-Marke überwinde - wonach es aber nach dem miserablen Jahresbeginn überhaupt nicht aussehe.
In diesem Bereich verläuft die "Nackenlinie", also die Verbindungslinie zwischen den Hochpunkten seit dem vergangenen Herbst, die für eine Trendwende signifikant überschritten werden sollte. Je öfter ein Index an solchen Marken scheitert, desto mehr gewinnen diese als Widerstand an Kraft. Allein schon deshalb, weil sich immer mehr Anleger an ihnen orientieren. Die Prognose erfüllt sich also selbst.
Eine ganze Reihe negativer Faktoren belastet den Markt. Dazu zählt neben dem überaus schlechten fundamentalen Umfeld, das für die Zunft nur eine untergeordnete Rolle spielt, die fallende 200-Tage-Linie. Sie berechnet sich aus dem Kursdurchschnitt der vergangenen 200 Handelstage. Auch der Trend, dass jedes Kurshoch unter dem vergangenen liegt, jedes Tief das vorangegangene aber unterschreitet, stimmt die Experten skeptisch. Ebenso wie in der Baisse bis 2003 fallen Zwischenerholungen zwar heftig aus, verpuffen aber rasch wieder.
Sollte das bisherige Tief von 4 000 Punkten nicht halten, sehen WestLB-Experte Henke und der bankenunabhängige Charttechniker Frederik Altmann den Dax bis auf 3 300 Punkte fallen.
Auf dieses Niveau wäre der Index im November gefallen, hätte ihn die zeitgleich bis auf 1 000 Euro gestiegene VW-Aktie nicht um 700 Punkte nach oben verzerrt.
"Im November erlebten wir klare Anzeichen von Panik", sagt UBS-Stratege Riesner. Dazu zählten Bankenpleiten, Befürchtungen einer Weltrezession und Deflation sowie schlechte Stimmungsindikatoren bei extrem hohen Handelsumsätzen.
All das deutet üblicherweise auf einen Ausverkauf und eine Kapitulation der Anleger hin, denen anschließend steigende Kurse folgen. Vorstellung dabei ist, dass jedermann verkauft und anschließend negative Nachrichten keinen Kursdruck mehr auszuüben vermögen.
Dennoch erwartet Riesner nach einem nur kurzen Zwischenspurt erneut fallende Kurse. Bezogen auf den weltweit wichtigsten Börsenindex, dem amerikanischen S&P 500, rechnet er mit neuen Tiefs im Bereich von 670 oder gar 630 Punkten. Aktuell notiert das Börsenbarometer 30 Prozent höher.
Der S&P beeinflusst alle europäischen Börsenindizes stark. Überaus pessimistisch stimmt Riesner die V-förmige Chartformation beim S&P 500: Sehr heftig und rasch fallenden Kursen bis November folgten ebenso stark steigende.
Experte Riesner hat in diesem Zusammenhang alle 18 Bärenmärkte seit 1932 untersucht. Sein Ergebnis: Mit nur einer Ausnahme mündeten große Börsenabschwünge, wie wir sie auch jetzt erleben, nie mit einer V-förmigen Erholung in eine neue Hausse. Nur 1942, als die Märkte den Kriegseintritt der USA als Wende feierten, gab es nach einer V-förmigen Erholung keine neuen großen Rückschläge mehr.
"Warum sollte uns solch ein Kunststück ausgerechnet diesmal gelingen?", fragt Riesner mit Blick auf die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise. Das geringe zeitliche Ausmaß der laufenden Baisse von nur 13 Monaten mache ein Ende der Talfahrt schon zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich. Im Durchschnitt dauerten Bärenmärkte 21,5 Monate.
Einzig Klaus Deppermann von der BHF Bank versprüht etwas Optimismus. Er sieht die im November begonnene Bodenbildung hinreichend unterstützt. "Schon in den nächsten Tagen sollte die Talfahrt spätestens leicht unterhalb der bisherigen Tiefstände stoppen und in eine kräftige, mehrmonatige Erholung münden", sagt Deppermann. Die technischen Indikatoren ließen einen Anstieg des Dax bis auf 6 200 Punkte zu.
Doch die Geburt eines Bullenmarktes vermag auch er weit und breit nicht zu erkennen.
Rückblende
"Dax bleibt an 8 000 Punkten hängen", titelte das Handelsblatt im Dezember 2007 nach dem Frankfurter Gespräch mit technischen Analysten. Die Zunft war sich damals einig, dass der Dax die Marke nicht nachhaltig überwinden könne. "Das bisherige Jahres- und Allzeithoch bei 8 152 Punkten stelle eine sehr schwere Hürde dar", war das Fazit. Anders als die meisten fundamentalen Analysten prognostizierten vor gut einem Jahr die Charttechniker mit Blick auf 2008 fallende Kurse.
Die Realität gab den Experten recht. Im Januar nahm der Dax noch einmal Anlauf auf neue Hochs, prallte daran aber ab. Die Kurse fielen. Allerdings hielten die technischen Analysten das mögliche Abwärtspotenzial im Dezember 2007 für begrenzt. Dass sich der Dax glatt halbieren würde, prophezeite niemand.
Frankfurter Gespräch des Handelsblatts
Charttechniker schlagen Alarm
DÜSSELDORF/FRANKFURT.
Nach dramatisch fallenden Kursen gleich zu Jahresbeginn erwarten die Analysten allenfalls kurzfristig eine Erholung. "Der Markt ist extrem überverkauft", sagt Michael Riesner von der Schweizer Großbank UBS. Technisch orientierte Analysten leiten aus dem Verlauf der Kurscharts Rückschlüsse auf die Zukunft ab.
Inmitten der schweren Baisse beim Platzen der Internetblase hatten viele Charttechniker 2001 und 2002 trotz stark gefallener Kurse vor einem Einstieg gewarnt. Seitdem orientieren sich auch in Europa viele Investoren am Verlauf der Charts. Eine Fülle von Computerprogrammen sind daraus ausgerichtet. In den USA genießt die Zunft seit den legendären Erfolgen des Börsenaltmeisters Jesse Livermore in der Panik von 1907 und der Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1932 hohes Ansehen.
Von einer ausgeprägten Baisse spricht Christian Henke von der WestLB: "Erholungen sind nur kurze Gegenbewegungen innerhalb eines intakten Abwärtstrends." Von einer Kehrtwende ließe sich erst dann sprechen, wenn der Dax die 5 300er-Marke überwinde - wonach es aber nach dem miserablen Jahresbeginn überhaupt nicht aussehe.
In diesem Bereich verläuft die "Nackenlinie", also die Verbindungslinie zwischen den Hochpunkten seit dem vergangenen Herbst, die für eine Trendwende signifikant überschritten werden sollte. Je öfter ein Index an solchen Marken scheitert, desto mehr gewinnen diese als Widerstand an Kraft. Allein schon deshalb, weil sich immer mehr Anleger an ihnen orientieren. Die Prognose erfüllt sich also selbst.
Eine ganze Reihe negativer Faktoren belastet den Markt. Dazu zählt neben dem überaus schlechten fundamentalen Umfeld, das für die Zunft nur eine untergeordnete Rolle spielt, die fallende 200-Tage-Linie. Sie berechnet sich aus dem Kursdurchschnitt der vergangenen 200 Handelstage. Auch der Trend, dass jedes Kurshoch unter dem vergangenen liegt, jedes Tief das vorangegangene aber unterschreitet, stimmt die Experten skeptisch. Ebenso wie in der Baisse bis 2003 fallen Zwischenerholungen zwar heftig aus, verpuffen aber rasch wieder.
Sollte das bisherige Tief von 4 000 Punkten nicht halten, sehen WestLB-Experte Henke und der bankenunabhängige Charttechniker Frederik Altmann den Dax bis auf 3 300 Punkte fallen.
Auf dieses Niveau wäre der Index im November gefallen, hätte ihn die zeitgleich bis auf 1 000 Euro gestiegene VW-Aktie nicht um 700 Punkte nach oben verzerrt.
"Im November erlebten wir klare Anzeichen von Panik", sagt UBS-Stratege Riesner. Dazu zählten Bankenpleiten, Befürchtungen einer Weltrezession und Deflation sowie schlechte Stimmungsindikatoren bei extrem hohen Handelsumsätzen.
All das deutet üblicherweise auf einen Ausverkauf und eine Kapitulation der Anleger hin, denen anschließend steigende Kurse folgen. Vorstellung dabei ist, dass jedermann verkauft und anschließend negative Nachrichten keinen Kursdruck mehr auszuüben vermögen.
Dennoch erwartet Riesner nach einem nur kurzen Zwischenspurt erneut fallende Kurse. Bezogen auf den weltweit wichtigsten Börsenindex, dem amerikanischen S&P 500, rechnet er mit neuen Tiefs im Bereich von 670 oder gar 630 Punkten. Aktuell notiert das Börsenbarometer 30 Prozent höher.
Der S&P beeinflusst alle europäischen Börsenindizes stark. Überaus pessimistisch stimmt Riesner die V-förmige Chartformation beim S&P 500: Sehr heftig und rasch fallenden Kursen bis November folgten ebenso stark steigende.
Experte Riesner hat in diesem Zusammenhang alle 18 Bärenmärkte seit 1932 untersucht. Sein Ergebnis: Mit nur einer Ausnahme mündeten große Börsenabschwünge, wie wir sie auch jetzt erleben, nie mit einer V-förmigen Erholung in eine neue Hausse. Nur 1942, als die Märkte den Kriegseintritt der USA als Wende feierten, gab es nach einer V-förmigen Erholung keine neuen großen Rückschläge mehr.
"Warum sollte uns solch ein Kunststück ausgerechnet diesmal gelingen?", fragt Riesner mit Blick auf die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise. Das geringe zeitliche Ausmaß der laufenden Baisse von nur 13 Monaten mache ein Ende der Talfahrt schon zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich. Im Durchschnitt dauerten Bärenmärkte 21,5 Monate.
Einzig Klaus Deppermann von der BHF Bank versprüht etwas Optimismus. Er sieht die im November begonnene Bodenbildung hinreichend unterstützt. "Schon in den nächsten Tagen sollte die Talfahrt spätestens leicht unterhalb der bisherigen Tiefstände stoppen und in eine kräftige, mehrmonatige Erholung münden", sagt Deppermann. Die technischen Indikatoren ließen einen Anstieg des Dax bis auf 6 200 Punkte zu.
Doch die Geburt eines Bullenmarktes vermag auch er weit und breit nicht zu erkennen.
Rückblende
"Dax bleibt an 8 000 Punkten hängen", titelte das Handelsblatt im Dezember 2007 nach dem Frankfurter Gespräch mit technischen Analysten. Die Zunft war sich damals einig, dass der Dax die Marke nicht nachhaltig überwinden könne. "Das bisherige Jahres- und Allzeithoch bei 8 152 Punkten stelle eine sehr schwere Hürde dar", war das Fazit. Anders als die meisten fundamentalen Analysten prognostizierten vor gut einem Jahr die Charttechniker mit Blick auf 2008 fallende Kurse.
Die Realität gab den Experten recht. Im Januar nahm der Dax noch einmal Anlauf auf neue Hochs, prallte daran aber ab. Die Kurse fielen. Allerdings hielten die technischen Analysten das mögliche Abwärtspotenzial im Dezember 2007 für begrenzt. Dass sich der Dax glatt halbieren würde, prophezeite niemand.
Deutsche Börse lockert Fast-Entry-Regeln für den Leitindex DAX
FRANKFURT (AWP International) -
Die Deutsche Börse hat aufgrund der deutlich gestiegenen Volatilität und kräftiger Rückgänge beim Börsenumsatz der grossen DAX30-Konzerne ihre Fast-Entry-Regeln für den Leitindex gelockert. Sofern bei den regelmässigen ausserordentlichen Überprüfungen im DAX der Fast-Exit-Fall eintrete, werde künftig als Nachfolger derjenige Wert bestimmt, der in der Börsen-Rangliste bei der Marktkapitalisierung nach Streubesitz Rang 35 oder besser belegt.
Gleichzeitig genüge beim Börsenumsatz künftig ein Rang von 45 oder besser, teilte die Börse am Freitagabend nach einer Sitzung des Arbeitskreises Aktienindizes mit.
Diese Regel gelte vom kommenden Montag, 26. Januar, an.
Bislang galt bei der quartalsmässigen Überprüfung im März, Juni, September und Dezember für eine Fast-Entry-Aufnahme, dass das Unternehmen nach Marktkapitalisierung und Börsenumsatz zu den 25 grössten deutschen börsennotierten Konzernen gehören, also jeweils auf Rang 25 oder besser platziert sein musste.
UNGLEICHGEWICHT ENTSTANDEN
Wie es seitens der Börse hiess, sei ein Ungleichgewicht zwischen den beiden Kriterien Marktkapitalisierung und Börsenumsatz entstanden, da bei der Überprüfung der Ranglisten jeweils Ende Februar, Mai, August und November die Marktkapitalisierung auf Basis der gewichteten Durchschnittskurse der letzten 20 Handelstage berücksichtigt werde. Für die Börsenumsätze jedoch werden - mit Ausnahme von Neuemissionen, wo hochgerechnet wird - die letzten zwölf Monate herangezogen.
Unverändert bleibt dagegen aber die Regel für den Fast-Exit: Ein DAX30-Wert muss nach wie vor ersetzt werden, wenn er in einem der beiden Kriterien Börsenumsatz oder Marktkapitalisierung einen Rang schlechter als 45 auf der Kandidatenrangliste belegt.
Der nächste Termin für die planmässige Überprüfung der Aktienindizes der Deutschen Börse ist der 4. März 2009./ck/he
FRANKFURT (AWP International) -
Die Deutsche Börse hat aufgrund der deutlich gestiegenen Volatilität und kräftiger Rückgänge beim Börsenumsatz der grossen DAX30-Konzerne ihre Fast-Entry-Regeln für den Leitindex gelockert. Sofern bei den regelmässigen ausserordentlichen Überprüfungen im DAX der Fast-Exit-Fall eintrete, werde künftig als Nachfolger derjenige Wert bestimmt, der in der Börsen-Rangliste bei der Marktkapitalisierung nach Streubesitz Rang 35 oder besser belegt.
Gleichzeitig genüge beim Börsenumsatz künftig ein Rang von 45 oder besser, teilte die Börse am Freitagabend nach einer Sitzung des Arbeitskreises Aktienindizes mit.
Diese Regel gelte vom kommenden Montag, 26. Januar, an.
Bislang galt bei der quartalsmässigen Überprüfung im März, Juni, September und Dezember für eine Fast-Entry-Aufnahme, dass das Unternehmen nach Marktkapitalisierung und Börsenumsatz zu den 25 grössten deutschen börsennotierten Konzernen gehören, also jeweils auf Rang 25 oder besser platziert sein musste.
UNGLEICHGEWICHT ENTSTANDEN
Wie es seitens der Börse hiess, sei ein Ungleichgewicht zwischen den beiden Kriterien Marktkapitalisierung und Börsenumsatz entstanden, da bei der Überprüfung der Ranglisten jeweils Ende Februar, Mai, August und November die Marktkapitalisierung auf Basis der gewichteten Durchschnittskurse der letzten 20 Handelstage berücksichtigt werde. Für die Börsenumsätze jedoch werden - mit Ausnahme von Neuemissionen, wo hochgerechnet wird - die letzten zwölf Monate herangezogen.
Unverändert bleibt dagegen aber die Regel für den Fast-Exit: Ein DAX30-Wert muss nach wie vor ersetzt werden, wenn er in einem der beiden Kriterien Börsenumsatz oder Marktkapitalisierung einen Rang schlechter als 45 auf der Kandidatenrangliste belegt.
Der nächste Termin für die planmässige Überprüfung der Aktienindizes der Deutschen Börse ist der 4. März 2009./ck/he
Die Insel hat ein ziemlich dickes Problem 
Kurzfristig im Aufwind
23.01.2009 21:54
Das britische Pfund befindet sich am Freitagabend gegenüber dem US-Dollar kurzfristig im Aufwind, nachdem es gegen Mittag noch ein 23-Jahres-Tief bei 1,3502 erreicht hatte. Nach der Rückeroberung der 20-Stunden-Linie von 1,3699 konnte das Währungspaar wieder bis 1,3795 ansteigen, da der seine Kursverluste eindämmende Dow Jones Index den Trend zu Kapitalflüssen in den Greenback stoppte. Das nächste Kursziel auf der Oberseite liefert die 1,3880, um 20:52 Uhr UTC wird GBP/USD mit 1,3789 gehandelt. (vz/FXdirekt)
erreicht hatte. Nach der Rückeroberung der 20-Stunden-Linie von 1,3699 konnte das Währungspaar wieder bis 1,3795 ansteigen, da der seine Kursverluste eindämmende Dow Jones Index den Trend zu Kapitalflüssen in den Greenback stoppte. Das nächste Kursziel auf der Oberseite liefert die 1,3880, um 20:52 Uhr UTC wird GBP/USD mit 1,3789 gehandelt. (vz/FXdirekt)
Pfund/Dollar
 :shock:
:shock:
Dollar/Pfund

Zum Euro fast pari
Pfund/Euro

Euro/Pfund

Kurzfristig im Aufwind
23.01.2009 21:54
Das britische Pfund befindet sich am Freitagabend gegenüber dem US-Dollar kurzfristig im Aufwind, nachdem es gegen Mittag noch ein 23-Jahres-Tief bei 1,3502
Pfund/Dollar
Dollar/Pfund
Zum Euro fast pari
Pfund/Euro
Euro/Pfund
Netz von Lade- und Wechselstationen für Elektroautos in Deutschland geplant
Nach Dänemark will das vor zwei Jahren gegründete kalifornische Unternehmen Better Place des früheren SAP-Managers Shai Agassi nun auch in Deutschland ein flächendeckendes Netz von Lade- und Akkuwechselstationen für Elektrofahrzeuge aufbauen. Rolf Schumann, der Projektleiter für Deutschland und Europa, sagte dem Handelsblatt, dass das Unternehmen dieses Jahr trotz der Autoabsatzkrise eine Entscheidung treffen werde: "Ich sehe gute Chancen für einen Start."
Better Place habe bereits mit Politikern und deutschen Autoherstellern, die Elektrofahrzeuge bauen wollen, Gespräche aufgenommen. Bislang allerdings setzt das Unternehmen bei seinen Projekten in Dänemark, Israel, Australien, Kalifornien, Ontario und Hawaii auf Fahrzeuge des Partners Renault-Nissan. Die deutschen Autobauer wie Daimler oder Volkswagen streben derzeit an, selbst Akkus für die E-Autos zu entwickeln. Better Place will sich hier nicht als Konkurrent präsentieren: "Das ist ein altes Denken, das den alten Strukturen verhaftet ist. Wir sind sicher, dass auch die Autobatterie langfristig nicht ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal für die Hersteller sein wird, sondern lediglich der intelligente Einsatz der Stromquelle."
Better Place will Fahrzeuge mit Strom in ähnlicher Weise versorgen, wie Mobiltelefone den Zugang zum Funknetz erhalten. Anstelle von Minutenkontingenten soll es Kilometerkontingente geben, für die das Netz von Lade- und Akkutauschstationen verfügbar ist. Die Austausch-Akkus bleiben Eigentum von Better Place.
http://www.heise.de/newsticker/Netz-von-Lade-und-Wechselstationen-fuer-Elektroautos-in-Deutschland-geplant--/meldung/122516
Nach Dänemark will das vor zwei Jahren gegründete kalifornische Unternehmen Better Place des früheren SAP-Managers Shai Agassi nun auch in Deutschland ein flächendeckendes Netz von Lade- und Akkuwechselstationen für Elektrofahrzeuge aufbauen. Rolf Schumann, der Projektleiter für Deutschland und Europa, sagte dem Handelsblatt, dass das Unternehmen dieses Jahr trotz der Autoabsatzkrise eine Entscheidung treffen werde: "Ich sehe gute Chancen für einen Start."
Better Place habe bereits mit Politikern und deutschen Autoherstellern, die Elektrofahrzeuge bauen wollen, Gespräche aufgenommen. Bislang allerdings setzt das Unternehmen bei seinen Projekten in Dänemark, Israel, Australien, Kalifornien, Ontario und Hawaii auf Fahrzeuge des Partners Renault-Nissan. Die deutschen Autobauer wie Daimler oder Volkswagen streben derzeit an, selbst Akkus für die E-Autos zu entwickeln. Better Place will sich hier nicht als Konkurrent präsentieren: "Das ist ein altes Denken, das den alten Strukturen verhaftet ist. Wir sind sicher, dass auch die Autobatterie langfristig nicht ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal für die Hersteller sein wird, sondern lediglich der intelligente Einsatz der Stromquelle."
Better Place will Fahrzeuge mit Strom in ähnlicher Weise versorgen, wie Mobiltelefone den Zugang zum Funknetz erhalten. Anstelle von Minutenkontingenten soll es Kilometerkontingente geben, für die das Netz von Lade- und Akkutauschstationen verfügbar ist. Die Austausch-Akkus bleiben Eigentum von Better Place.
http://www.heise.de/newsticker/Netz-von-Lade-und-Wechselstationen-fuer-Elektroautos-in-Deutschland-geplant--/meldung/122516
Die Verflechtungen der Autobranche
Der Wettbewerb in der Autobranche wird sich in den nächsten Jahren noch verschärfen. Autobauer müssten kreative Kooperationsmodelle entwickeln, sagen Experten, denn nur so ließen sich Kosten sparen. Im Überlebenskampf kommt es auf die richtigen Partner an. Deswegen bandeln Produzenten miteinander an und legen Entwicklung, Produktion und Vertrieb zusammen. Wer mit wem unter einer Decke steckt, zeigt diese Infografik.
Wählen Sie einen Hersteller aus um die Verflechtungen neu zu sortieren und fahren Sie mit der Maus über die Linien um näheres über die Art der Verbindung zu Erfahren.
--> Infografik
Der Wettbewerb in der Autobranche wird sich in den nächsten Jahren noch verschärfen. Autobauer müssten kreative Kooperationsmodelle entwickeln, sagen Experten, denn nur so ließen sich Kosten sparen. Im Überlebenskampf kommt es auf die richtigen Partner an. Deswegen bandeln Produzenten miteinander an und legen Entwicklung, Produktion und Vertrieb zusammen. Wer mit wem unter einer Decke steckt, zeigt diese Infografik.
Wählen Sie einen Hersteller aus um die Verflechtungen neu zu sortieren und fahren Sie mit der Maus über die Linien um näheres über die Art der Verbindung zu Erfahren.
--> Infografik
Fluggesellschaften
Lufthansa kritisiert Hilfen für Airbus-Kunden
von Jens Koenen
An vollen Auftragsbücher mangelt es Airbus nicht, allerdings an dem Vertrauen, dass die Kunden all die bestellten Flugzeuge auch werden bezahlen können. Daher plant die Bundesregierung, den Kunden des europäischen Flugzeugherstellers finanziell zu helfen. Die Lufthansa hält davon gar nichts. Da bahnt sich Streit an.
SAN JOSE DOS CMAPUS. Die zweitgrößte europäische Fluggesellschaft fürchtet Marktverzerrungen. „Konkurrenz ist gut, aber wir wollen faire Konkurrenz. Und wir wollen nicht für unsere konservative Finanzierung bestraft werden“, sagte Nico Buchholz, Senior Vice President und für die LH-Flotte zuständiger Manager, am Rande einer Flugzeugübergabe an die LH-Tochter Air Dolomiti in Sao Jose in Brasilien.
Die Bundesregierung hatte Mitte der Woche angekündigt, Airlines, die wegen der zurückhaltenden Banken Probleme bei der Finanzierung neuer Flugzeuge bekommen, zur Seite springen zu wollen. Das noch nicht endgültig feststehende Programm sieht zum einen direkte Kredite für die Kunden vor, zum anderen die Absicherung von Exportfinanzierungen durch Hermes.
In den zurückliegenden Wochen hatten sich Meldungen gehäuft, wonach Fluggesellschaften zunehmend Probleme bei der Finanzierung ihrer bestellten Flugzeuge bekommen. Hinzu kommt die Nachfrageschwäche im Passagier- und vor allem Frachtverkehr. Daraufhin hat die chinesische Luftfahrtbehörde CAAC die heimischen Airlines angewiesen, geplante Neuanschaffungen zu verschieben. Alleine Airbus hat aus China rund 430 Bestellungen vorliegen. Auch der LH-Rivale Air France-KLM hatte vor wenigen Tagen erklärt, Investitionen in seine Flotte kürzen zu wollen.
Lufthansa hat Flugzeuge im Wert von rund 14 Mrd. Euro bestellt, darunter das Großraumflugzeug Airbus A380. Buchholz betonte, es werde keine Änderungen bei diesen Bestellungen geben. Die Käufe würden weitgehend aus den eigenen Mitteln bezahlt, Hilfen seien nicht notwendig. „Ein Unterschied etwa zu Air France ist sicherlich unsere konservative Finanzstruktur. Wir haben immer noch einen Investmentgrade", sagte Buchholz.
Die schwierige wirtschaftliche Situation sowie die Finanzierungsprobleme könnten sich auch negativ auf das Großraumflugzeug A380 auswirken. So prüfen offensichtlich mehrere Fluggesellschaften eine Verschiebung des Betriebsstarts. „Ich kenne mindestens drei Airlines, die über so etwas nachdenken“, sagte ein Branchenkenner. Es sei einfach nicht die Zeit, zusätzliche Kapazitäten aufzubauen. Lufthansa will den ersten A 380 im Sommerflugplan 2010 in Betrieb nehmen. Das würde eine Auslieferung um den Jahreswechsel bedeuten. Daran wird sich nach den Worten des LH-Managers Buchholz ungeachtet der Krise nichts ändern.
Selbst bei den zuletzt stark nachgefragten kleineren Flugzeugen mit bis zu 120 Sitzen wirkt sich die aktuelle Krise aus. So will der brasilianische Hersteller Embraer, neben Bombardier der größte Anbieter von Regionalflugzeugen, die Produktion von kommerziellen Flugzeugen 2009 von 165 im vergangenen Jahr auf 125 reduzieren. Auch die Brasilianer berichten von ersten Finanzierungsproblemen auf Kundenseite. „Es ist nicht die Zeit für eine Expansion. Wir planen lieber konservativ und vorsichtig“, sagte Mauro Kern, der Chef der Embraer-Sparte kommerzielle Luftfahrt.
Mauro bekräftigte zwar, dass es bis heute noch keine Abstellungen gegeben habe. „Wir führen aber Gespräche mit mehreren Kunden über eine Verschiebung der Auslieferung“, sagte er.
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-dienstleister/lufthansa-kritisiert-hilfen-fuer-airbus-kunden;2137705
Lufthansa kritisiert Hilfen für Airbus-Kunden
von Jens Koenen
An vollen Auftragsbücher mangelt es Airbus nicht, allerdings an dem Vertrauen, dass die Kunden all die bestellten Flugzeuge auch werden bezahlen können. Daher plant die Bundesregierung, den Kunden des europäischen Flugzeugherstellers finanziell zu helfen. Die Lufthansa hält davon gar nichts. Da bahnt sich Streit an.
SAN JOSE DOS CMAPUS. Die zweitgrößte europäische Fluggesellschaft fürchtet Marktverzerrungen. „Konkurrenz ist gut, aber wir wollen faire Konkurrenz. Und wir wollen nicht für unsere konservative Finanzierung bestraft werden“, sagte Nico Buchholz, Senior Vice President und für die LH-Flotte zuständiger Manager, am Rande einer Flugzeugübergabe an die LH-Tochter Air Dolomiti in Sao Jose in Brasilien.
Die Bundesregierung hatte Mitte der Woche angekündigt, Airlines, die wegen der zurückhaltenden Banken Probleme bei der Finanzierung neuer Flugzeuge bekommen, zur Seite springen zu wollen. Das noch nicht endgültig feststehende Programm sieht zum einen direkte Kredite für die Kunden vor, zum anderen die Absicherung von Exportfinanzierungen durch Hermes.
In den zurückliegenden Wochen hatten sich Meldungen gehäuft, wonach Fluggesellschaften zunehmend Probleme bei der Finanzierung ihrer bestellten Flugzeuge bekommen. Hinzu kommt die Nachfrageschwäche im Passagier- und vor allem Frachtverkehr. Daraufhin hat die chinesische Luftfahrtbehörde CAAC die heimischen Airlines angewiesen, geplante Neuanschaffungen zu verschieben. Alleine Airbus hat aus China rund 430 Bestellungen vorliegen. Auch der LH-Rivale Air France-KLM hatte vor wenigen Tagen erklärt, Investitionen in seine Flotte kürzen zu wollen.
Lufthansa hat Flugzeuge im Wert von rund 14 Mrd. Euro bestellt, darunter das Großraumflugzeug Airbus A380. Buchholz betonte, es werde keine Änderungen bei diesen Bestellungen geben. Die Käufe würden weitgehend aus den eigenen Mitteln bezahlt, Hilfen seien nicht notwendig. „Ein Unterschied etwa zu Air France ist sicherlich unsere konservative Finanzstruktur. Wir haben immer noch einen Investmentgrade", sagte Buchholz.
Die schwierige wirtschaftliche Situation sowie die Finanzierungsprobleme könnten sich auch negativ auf das Großraumflugzeug A380 auswirken. So prüfen offensichtlich mehrere Fluggesellschaften eine Verschiebung des Betriebsstarts. „Ich kenne mindestens drei Airlines, die über so etwas nachdenken“, sagte ein Branchenkenner. Es sei einfach nicht die Zeit, zusätzliche Kapazitäten aufzubauen. Lufthansa will den ersten A 380 im Sommerflugplan 2010 in Betrieb nehmen. Das würde eine Auslieferung um den Jahreswechsel bedeuten. Daran wird sich nach den Worten des LH-Managers Buchholz ungeachtet der Krise nichts ändern.
Selbst bei den zuletzt stark nachgefragten kleineren Flugzeugen mit bis zu 120 Sitzen wirkt sich die aktuelle Krise aus. So will der brasilianische Hersteller Embraer, neben Bombardier der größte Anbieter von Regionalflugzeugen, die Produktion von kommerziellen Flugzeugen 2009 von 165 im vergangenen Jahr auf 125 reduzieren. Auch die Brasilianer berichten von ersten Finanzierungsproblemen auf Kundenseite. „Es ist nicht die Zeit für eine Expansion. Wir planen lieber konservativ und vorsichtig“, sagte Mauro Kern, der Chef der Embraer-Sparte kommerzielle Luftfahrt.
Mauro bekräftigte zwar, dass es bis heute noch keine Abstellungen gegeben habe. „Wir führen aber Gespräche mit mehreren Kunden über eine Verschiebung der Auslieferung“, sagte er.
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-dienstleister/lufthansa-kritisiert-hilfen-fuer-airbus-kunden;2137705
Teile für den A350 XWB
Airbus baut in China
Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat mit chinesischen Partnern die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zum Bau von Verbundfaserstoffen besiegelt. Die chinesische Airbus-Sparte werde daran 20 Prozent halten und die Harbin Aircraft Industry Group (HAIG) 50 Prozent, teilte der zum EADS-Konzern gehörende Flugzeugbauer mit. Die übrigen 30 Prozent übernehmen demnach zu gleichen Teilen die chinesischen Unternehmen HAI, AviChina und HELI.
In der neuen Produktionsanlage sollen Teile und bereits zusammengesetzte Elemente für das neue Langstreckenflugzeug A350 XWB sowie die A320-Maschinen gefertigt werden. Es soll nach Angaben von Airbus bereits im September dieses Jahres in Betrieb gehen. Eine weitere Anlage soll 2010 ihren Dienst aufnehmen.
Zudem kündigte Airbus in einer Mitteilung an seine Mitarbeiter an, im Juli seine erste außerhalb von Europa gefertigte Maschine an die chinesische Sichuan Airlines auszuliefern. Das Unternehmen hatte im September damit begonnen, ältere Modelle des Typs A320 in der Nähe von Peking zusammenzubauen. Die Teile dafür wurden aus Europa per Schiff nach China transportiert. Airbus und sein Konkurrent Boeing wenden sich verstärkt dem wachsenden asiatischen Markt - insbesondere China - zu.
http://www.n-tv.de/1095103.html
Airbus baut in China
Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat mit chinesischen Partnern die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zum Bau von Verbundfaserstoffen besiegelt. Die chinesische Airbus-Sparte werde daran 20 Prozent halten und die Harbin Aircraft Industry Group (HAIG) 50 Prozent, teilte der zum EADS-Konzern gehörende Flugzeugbauer mit. Die übrigen 30 Prozent übernehmen demnach zu gleichen Teilen die chinesischen Unternehmen HAI, AviChina und HELI.
In der neuen Produktionsanlage sollen Teile und bereits zusammengesetzte Elemente für das neue Langstreckenflugzeug A350 XWB sowie die A320-Maschinen gefertigt werden. Es soll nach Angaben von Airbus bereits im September dieses Jahres in Betrieb gehen. Eine weitere Anlage soll 2010 ihren Dienst aufnehmen.
Zudem kündigte Airbus in einer Mitteilung an seine Mitarbeiter an, im Juli seine erste außerhalb von Europa gefertigte Maschine an die chinesische Sichuan Airlines auszuliefern. Das Unternehmen hatte im September damit begonnen, ältere Modelle des Typs A320 in der Nähe von Peking zusammenzubauen. Die Teile dafür wurden aus Europa per Schiff nach China transportiert. Airbus und sein Konkurrent Boeing wenden sich verstärkt dem wachsenden asiatischen Markt - insbesondere China - zu.
http://www.n-tv.de/1095103.html
Weltwirtschaftsforum
Politiker die Stars von Davos 2009
von Matt Moore
Verkehrte Welt in Davos: Während zuletzt die Industriebosse die Stars des Weltwirtschaftsforums waren, rückten 2009 die Politiker ins Rampenlicht. Angesichts der Wirtschaftskrise ist die Glaubwürdigkeit der Vorstandsvorsitzenden und Unternehmensführer geschwunden.
Sie sind kaum noch in einer Position, den Regierungen zu raten, sich ausschließlich auf die Politik zu konzentrieren. "Die Zahl der VIP-Politiker ist groß und es sind in diesem Jahr viel weniger Banker da", sagte Airbus-Sprecher Rainer Ohler. "Die ganz Großen im Bankwesen fehlen."
Bisher war Davos in der Welt des Big Business der Ort, um zu sehen und gesehen zu werden. Doch der Fokus hat sich verschoben. In diesem Jahr standen Bundeskanzlerin Angela Merkel, der russische Ministerpräsident Wladimir Putin, sein chinesischer Kollege Wen Jiabao und der britische Premierminister Gordon Brown im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, um nur einige der 40 Staats- und Regierungschefs in Davos zu nennen.
Sie brachten ihre Erfahrung und in einigen Fällen ihr ganzes politisches Gewicht mit. Brown betonte, man wolle nicht Einzelne kritisieren. Allerdings dürften unverantwortliche Entscheidungen und exzessive Risiken nicht belohnt werden. Stattdessen forderten der Premierminister und seine Kollegen eine stärkere internationale Regulierung. Merkel sagte, es sei ein klarer Kompass notwendig, um eine Wiederholung vergangener Krisen zu verhindern.
Der dänische Ministerpräsident Anders Fogh Rasmussen begrüßte die Anwesenheit so vieler Politiker in Davos. So können leichter Lösungen für die Wirtschaftskrise gefunden und ehrgeizige Ziele zum Klimaschutz vereinbart werden.
Den Regierungen seien jedoch auch Grenze gesetzt, sagte Ohler. "Es gibt gewisse Gebiete, auf denen Regierungen handeln müssen und andere, auf denen die Finanzmärkte die Dinge regeln sollten", sagte er. "Regierungen sind nicht die Antwort. Wir müssen alle unsere Hausaufgaben machen und auf uns selbst aufpassen." Auch der schwedische Ministerpräsident Fredrik Reinfeldt sprach sich für Lösungen in Kooperation mit der Wirtschaft aus.
In Davos wurde auch betont, dass nicht alle Unternehmen für die Entstehung der Krise verantwortlich seien. Pepsi-Chefin Indra Nooyi sagte, 90 Prozent der Firmen seien von großem Wert und arbeiteten reibungslos. In der Wall Street sei das jedoch nicht der Fall. Das sei wohl das Schicksal der schlechten Gesellschaft, sagte der Intel-Vorsitzende Craig Barrett. "Ich glaube nicht, dass der Laie unterscheidet, ob man Vorstandsvorsitzender in der verarbeitenden Industrie, in der Service-Industrie oder im Finanzwesen ist", sagte Barrett. "Das ist Sippenhaft."
http://www.ftd.de/politik/international/:Weltwirtschaftsforum-Politiker-die-Stars-von-Davos-2009/468562.html
Politiker die Stars von Davos 2009
von Matt Moore
Verkehrte Welt in Davos: Während zuletzt die Industriebosse die Stars des Weltwirtschaftsforums waren, rückten 2009 die Politiker ins Rampenlicht. Angesichts der Wirtschaftskrise ist die Glaubwürdigkeit der Vorstandsvorsitzenden und Unternehmensführer geschwunden.
Sie sind kaum noch in einer Position, den Regierungen zu raten, sich ausschließlich auf die Politik zu konzentrieren. "Die Zahl der VIP-Politiker ist groß und es sind in diesem Jahr viel weniger Banker da", sagte Airbus-Sprecher Rainer Ohler. "Die ganz Großen im Bankwesen fehlen."
Bisher war Davos in der Welt des Big Business der Ort, um zu sehen und gesehen zu werden. Doch der Fokus hat sich verschoben. In diesem Jahr standen Bundeskanzlerin Angela Merkel, der russische Ministerpräsident Wladimir Putin, sein chinesischer Kollege Wen Jiabao und der britische Premierminister Gordon Brown im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, um nur einige der 40 Staats- und Regierungschefs in Davos zu nennen.
Sie brachten ihre Erfahrung und in einigen Fällen ihr ganzes politisches Gewicht mit. Brown betonte, man wolle nicht Einzelne kritisieren. Allerdings dürften unverantwortliche Entscheidungen und exzessive Risiken nicht belohnt werden. Stattdessen forderten der Premierminister und seine Kollegen eine stärkere internationale Regulierung. Merkel sagte, es sei ein klarer Kompass notwendig, um eine Wiederholung vergangener Krisen zu verhindern.
Der dänische Ministerpräsident Anders Fogh Rasmussen begrüßte die Anwesenheit so vieler Politiker in Davos. So können leichter Lösungen für die Wirtschaftskrise gefunden und ehrgeizige Ziele zum Klimaschutz vereinbart werden.
Den Regierungen seien jedoch auch Grenze gesetzt, sagte Ohler. "Es gibt gewisse Gebiete, auf denen Regierungen handeln müssen und andere, auf denen die Finanzmärkte die Dinge regeln sollten", sagte er. "Regierungen sind nicht die Antwort. Wir müssen alle unsere Hausaufgaben machen und auf uns selbst aufpassen." Auch der schwedische Ministerpräsident Fredrik Reinfeldt sprach sich für Lösungen in Kooperation mit der Wirtschaft aus.
In Davos wurde auch betont, dass nicht alle Unternehmen für die Entstehung der Krise verantwortlich seien. Pepsi-Chefin Indra Nooyi sagte, 90 Prozent der Firmen seien von großem Wert und arbeiteten reibungslos. In der Wall Street sei das jedoch nicht der Fall. Das sei wohl das Schicksal der schlechten Gesellschaft, sagte der Intel-Vorsitzende Craig Barrett. "Ich glaube nicht, dass der Laie unterscheidet, ob man Vorstandsvorsitzender in der verarbeitenden Industrie, in der Service-Industrie oder im Finanzwesen ist", sagte Barrett. "Das ist Sippenhaft."
http://www.ftd.de/politik/international/:Weltwirtschaftsforum-Politiker-die-Stars-von-Davos-2009/468562.html
Das Schuldenloch
Deutschlands öffentliche Haushalte sind mit 1,5 Billionen Euro in den Miesen. Wie funktioniert der Schuldenstaat?
Sie sind wieder im Gespräch. Angesichts der milliardenschweren Konjunkturpakete, Bankenrettungsringe und Informationslücken der Kanzlerin bei Tilgungsraten in Nebenhaushalten redet die Republik auch wieder über ihre Schulden. Und davon hat sie jede Menge. Mit 1,5 Billionen Euro stehen Bund, Länder und Kommunen derzeit in der Kreide. Das Ziel der großen Koalition lautete: Trend- umkehr. Aber wegen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise kann sie das vergessen. Völlig aus dem Ruder gelaufen sind die Schulden dem deutschen Staat noch nicht, aber aufpassen muss er. Auch wenn der Vergleich hinkt, macht er doch die Dimension deutlich: Beim Bund stehen einer Verschuldung von etwa einer Billion Euro jährlich Steuereinnahmen in Höhe von knapp 250 Milliarden Euro gegenüber. Mit dem vierfachen Jahresnettoeinkommen ist auch mancher Privatmensch verschuldet, wenn er sich eine Immobilie leistet. Es gibt nur einen gravierenden Unterschied: Der Häuslebauer lebt nach einem strengen Tilgungsplan, der Staat lebt lieber ohne ein solches Korsett. Und der Immobilienkäufer steckt einen Großteil seines Einkommens in Zins und Tilgung, der Staat dagegen wenig und stürzt sich gern in zusätzliche Ausgaben für Subventionen oder Soziales, die er sich eigentlich nicht leisten kann. Der Häuslebauer hat im Normalfall irgendwann keine Schulden mehr, der moderne Staat aber kommt aus den Schulden nicht mehr heraus.
Wie verteilen sich die Staatsschulden?
Auf 1,5 Billionen Euro belaufen sich die Schulden des deutschen Staates – eine unvorstellbare Summe. Konkret heißt das, dass auf jedem Deutschen eine Staatsverschuldung von 18 280 Euro lastet (Stand Ende 2007). Geht man nur von den Steuerzahlern aus, klammert Kinder, Arme und Nichtverdiener aus, dann kommen noch einige tausend Euro dazu. Vor sieben Jahren waren es übrigens noch 15 195 Euro, unter Schwarz-Rot ist also die Staatsverschuldung immens gewachsen. Zu der einen Billion beim Bund kommen noch etwa 500 Milliarden bei den Ländern und etwa 80 Milliarden bei den Gemeinden. Insgesamt entsprach das 2008 etwa 63 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die Pensionsversprechen von Bund und Ländern belaufen sich auf 500 Milliarden Euro – die man streng genommen zu den Staatsschulden dazurechnen muss. Im Vergleich liegt Deutschland mit seinen Schulden auf einem Mittelplatz. Weit vorn liegt Japan mit knapp 130 Prozent, relativ sorglos können die Luxemburger mit 7,4 Prozent in die Zukunft schauen. Der EU-Schnitt liegt bei gut 58 Prozent, Die USA werden bald weit über 70 Prozent liegen, Großbritannien hat mit 45,6 Prozent Luft nach oben – die das Land auch gut brauchen kann.
Welche Schuldentöpfe gibt es?
Eigentlich dürfte es nur 17 davon geben – einen beim Bund und 16 bei den Bundesländern. Denn idealerweise ist der Schuldentopf immer der jeweilige Etat, den die Parlamente kontrollieren. Das ist ihr klassisches Recht. Allerdings neigen Regierungen dazu, außerdem noch Neben- oder Schattenhaushalte zu führen. Man spricht dabei etwas verschleiernd von „Sondervermögen“. Diese agieren quasi selbstständig und können sich auch eigenständig verschulden. Völlig intransparent sind sie aber nicht.
In den 90er Jahren richtete die Regierung Kohl zwei Sondertöpfe ein, um die Einheitsfolgen zu finanzieren. Mit dem Fonds Deutsche Einheit wurde die Infrastruktur der neuen Länder saniert, das Volumen betrug am Ende 82,2 Milliarden Euro. Als er 2005 wieder in den Bundeshaushalt integriert wurde, waren noch 38,6 Milliarden aus dem Topf abzutragen. Über den Erblastentilgungsfonds wurde der Bankrott der DDR finanziert – die Schulden der
Treuhandanstalt und die alten DDR-Schulden. Er startete 1995 mit einer Schuldenlast von knapp 172 Milliarden Euro, von denen bis 2009 etwa die Hälfte abgetragen war. Solche Sondertöpfe werden im Gegensatz zur Verschuldung im normalen Haushalt in der Regel mit Tilgungszielen ausgestattet – im Zusammenhang damit flossen in den Erblastentilgungsfonds regelmäßig alle Überschüsse der Bundesbank über 3,5 Milliarden Euro im Jahr. Das Ziel, 2011 bei null zu landen, ist aber nicht erreicht worden. Mittlerweile ist auch der Erblastentilgungsfonds im großen Bundesschuldentopf aufgegangen. Ein neues Sondervermögen ist der Tilgungsfonds zur Finanzierung der Investitionen im Konjunkturpaket II.
Wie verschuldet sich der Staat?
Der Staat holt sich das Geld, das er nicht über Steuern einnimmt, bei Kreditinstituten, großen Investoren, Versicherungen und nicht zuletzt bei Privatanlegern im In- und Ausland (direkt oder über Fonds und Versicherungen). Zu einem nicht geringen Teil (den man nicht genau beziffern kann) ist der Staat damit bei seinen eigenen Bürgern verschuldet, deren Steuerleistungspotenzial wiederum die Sicherheit dafür gibt, dass er sich verschulden kann – eine durchaus nicht grenzenlos stabile Konstellation. Die Hälfte der deutschen Schuldensumme haben ausländische Gläubiger geliehen.
Der Bund hat mehrere Instrumente der Verschuldung: die klassische Anleihe mit einer bestimmten Laufzeit, Obligationen, Schatzbriefe, Schatzanweisungen und neuerdings die Tagesanleihe, eine Art Geldmarktkonto, das auch Privatanleger nutzen können. Dafür zahlt er Zinsen – 2009 sind dafür beim Bund weit über 40 Milliarden Euro vorgesehen. Getilgt werden sollen 251 Milliarden Euro. Allerdings weniger durch Abbezahlen der Schulden als durch Umschulden. Das gehört zu den Hauptaufgaben der Schuldenverwaltung. Umschulden heißt: Der alte Kredit wird durch einen neuen getilgt und damit ersetzt. Das Umschulden gilt nicht als Neuverschuldung, was manche Verfassungsjuristen kritisch sehen. In den kommenden vier Jahren muss die Hälfte der Bundesschuld neu finanziert werden. Sollten die Zinsen mittelfristig deutlich steigen, weil derzeit alle Staaten der Welt wieder mehr Schulden machen, wird das teuer.
Wer profitiert von Staatsschulden?
Letztlich alle, die Vermögen anlegen können, je mehr, desto besser. Denn der deutsche Staat ist ein guter Schuldner, die Anlage ist relativ sicher. Ohne Staatsverschuldung würde die private Altersvorsorge bei uns nicht funktionieren, oder sie müsste weit stärker als bisher (wie in den USA) über Aktien, Unternehmens anleihen und sonstige weniger sichere Anlageformen erfolgen. Das Anlegen beim Staat wird durch die neue Abgeltungsteuer noch gefördert. Sie entlastet vor allem Vermögende, die Rentenpapiere der Firma Steinbrück & Co. kaufen.
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/Finanzen-Oeffentliche-Finanzen-Schulden;art130,2719663
Deutschlands öffentliche Haushalte sind mit 1,5 Billionen Euro in den Miesen. Wie funktioniert der Schuldenstaat?
Sie sind wieder im Gespräch. Angesichts der milliardenschweren Konjunkturpakete, Bankenrettungsringe und Informationslücken der Kanzlerin bei Tilgungsraten in Nebenhaushalten redet die Republik auch wieder über ihre Schulden. Und davon hat sie jede Menge. Mit 1,5 Billionen Euro stehen Bund, Länder und Kommunen derzeit in der Kreide. Das Ziel der großen Koalition lautete: Trend- umkehr. Aber wegen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise kann sie das vergessen. Völlig aus dem Ruder gelaufen sind die Schulden dem deutschen Staat noch nicht, aber aufpassen muss er. Auch wenn der Vergleich hinkt, macht er doch die Dimension deutlich: Beim Bund stehen einer Verschuldung von etwa einer Billion Euro jährlich Steuereinnahmen in Höhe von knapp 250 Milliarden Euro gegenüber. Mit dem vierfachen Jahresnettoeinkommen ist auch mancher Privatmensch verschuldet, wenn er sich eine Immobilie leistet. Es gibt nur einen gravierenden Unterschied: Der Häuslebauer lebt nach einem strengen Tilgungsplan, der Staat lebt lieber ohne ein solches Korsett. Und der Immobilienkäufer steckt einen Großteil seines Einkommens in Zins und Tilgung, der Staat dagegen wenig und stürzt sich gern in zusätzliche Ausgaben für Subventionen oder Soziales, die er sich eigentlich nicht leisten kann. Der Häuslebauer hat im Normalfall irgendwann keine Schulden mehr, der moderne Staat aber kommt aus den Schulden nicht mehr heraus.
Wie verteilen sich die Staatsschulden?
Auf 1,5 Billionen Euro belaufen sich die Schulden des deutschen Staates – eine unvorstellbare Summe. Konkret heißt das, dass auf jedem Deutschen eine Staatsverschuldung von 18 280 Euro lastet (Stand Ende 2007). Geht man nur von den Steuerzahlern aus, klammert Kinder, Arme und Nichtverdiener aus, dann kommen noch einige tausend Euro dazu. Vor sieben Jahren waren es übrigens noch 15 195 Euro, unter Schwarz-Rot ist also die Staatsverschuldung immens gewachsen. Zu der einen Billion beim Bund kommen noch etwa 500 Milliarden bei den Ländern und etwa 80 Milliarden bei den Gemeinden. Insgesamt entsprach das 2008 etwa 63 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die Pensionsversprechen von Bund und Ländern belaufen sich auf 500 Milliarden Euro – die man streng genommen zu den Staatsschulden dazurechnen muss. Im Vergleich liegt Deutschland mit seinen Schulden auf einem Mittelplatz. Weit vorn liegt Japan mit knapp 130 Prozent, relativ sorglos können die Luxemburger mit 7,4 Prozent in die Zukunft schauen. Der EU-Schnitt liegt bei gut 58 Prozent, Die USA werden bald weit über 70 Prozent liegen, Großbritannien hat mit 45,6 Prozent Luft nach oben – die das Land auch gut brauchen kann.
Welche Schuldentöpfe gibt es?
Eigentlich dürfte es nur 17 davon geben – einen beim Bund und 16 bei den Bundesländern. Denn idealerweise ist der Schuldentopf immer der jeweilige Etat, den die Parlamente kontrollieren. Das ist ihr klassisches Recht. Allerdings neigen Regierungen dazu, außerdem noch Neben- oder Schattenhaushalte zu führen. Man spricht dabei etwas verschleiernd von „Sondervermögen“. Diese agieren quasi selbstständig und können sich auch eigenständig verschulden. Völlig intransparent sind sie aber nicht.
In den 90er Jahren richtete die Regierung Kohl zwei Sondertöpfe ein, um die Einheitsfolgen zu finanzieren. Mit dem Fonds Deutsche Einheit wurde die Infrastruktur der neuen Länder saniert, das Volumen betrug am Ende 82,2 Milliarden Euro. Als er 2005 wieder in den Bundeshaushalt integriert wurde, waren noch 38,6 Milliarden aus dem Topf abzutragen. Über den Erblastentilgungsfonds wurde der Bankrott der DDR finanziert – die Schulden der
Treuhandanstalt und die alten DDR-Schulden. Er startete 1995 mit einer Schuldenlast von knapp 172 Milliarden Euro, von denen bis 2009 etwa die Hälfte abgetragen war. Solche Sondertöpfe werden im Gegensatz zur Verschuldung im normalen Haushalt in der Regel mit Tilgungszielen ausgestattet – im Zusammenhang damit flossen in den Erblastentilgungsfonds regelmäßig alle Überschüsse der Bundesbank über 3,5 Milliarden Euro im Jahr. Das Ziel, 2011 bei null zu landen, ist aber nicht erreicht worden. Mittlerweile ist auch der Erblastentilgungsfonds im großen Bundesschuldentopf aufgegangen. Ein neues Sondervermögen ist der Tilgungsfonds zur Finanzierung der Investitionen im Konjunkturpaket II.
Wie verschuldet sich der Staat?
Der Staat holt sich das Geld, das er nicht über Steuern einnimmt, bei Kreditinstituten, großen Investoren, Versicherungen und nicht zuletzt bei Privatanlegern im In- und Ausland (direkt oder über Fonds und Versicherungen). Zu einem nicht geringen Teil (den man nicht genau beziffern kann) ist der Staat damit bei seinen eigenen Bürgern verschuldet, deren Steuerleistungspotenzial wiederum die Sicherheit dafür gibt, dass er sich verschulden kann – eine durchaus nicht grenzenlos stabile Konstellation. Die Hälfte der deutschen Schuldensumme haben ausländische Gläubiger geliehen.
Der Bund hat mehrere Instrumente der Verschuldung: die klassische Anleihe mit einer bestimmten Laufzeit, Obligationen, Schatzbriefe, Schatzanweisungen und neuerdings die Tagesanleihe, eine Art Geldmarktkonto, das auch Privatanleger nutzen können. Dafür zahlt er Zinsen – 2009 sind dafür beim Bund weit über 40 Milliarden Euro vorgesehen. Getilgt werden sollen 251 Milliarden Euro. Allerdings weniger durch Abbezahlen der Schulden als durch Umschulden. Das gehört zu den Hauptaufgaben der Schuldenverwaltung. Umschulden heißt: Der alte Kredit wird durch einen neuen getilgt und damit ersetzt. Das Umschulden gilt nicht als Neuverschuldung, was manche Verfassungsjuristen kritisch sehen. In den kommenden vier Jahren muss die Hälfte der Bundesschuld neu finanziert werden. Sollten die Zinsen mittelfristig deutlich steigen, weil derzeit alle Staaten der Welt wieder mehr Schulden machen, wird das teuer.
Wer profitiert von Staatsschulden?
Letztlich alle, die Vermögen anlegen können, je mehr, desto besser. Denn der deutsche Staat ist ein guter Schuldner, die Anlage ist relativ sicher. Ohne Staatsverschuldung würde die private Altersvorsorge bei uns nicht funktionieren, oder sie müsste weit stärker als bisher (wie in den USA) über Aktien, Unternehmens anleihen und sonstige weniger sichere Anlageformen erfolgen. Das Anlegen beim Staat wird durch die neue Abgeltungsteuer noch gefördert. Sie entlastet vor allem Vermögende, die Rentenpapiere der Firma Steinbrück & Co. kaufen.
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/Finanzen-Oeffentliche-Finanzen-Schulden;art130,2719663
Fast die Hälfte des Geldes weg
Finanzkrise beutelt Anleger
Die Verschärfung der Finanzkrise hat Fonds-Anleger im vergangenen Jahr fast die Hälfte ihres Anlagevermögens gekostet. Investmentfonds, die in Aktien europäischer Unternehmen investieren, verloren 2008 im Schnitt 44,9 Prozent an Wert, wie der Branchenverband BVI unter Berufung auf seine aktuelle Wertentwicklungsstatistik mitteilte. Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland rutschten 2008 demnach um 43,6 Prozent ab. Investoren, die Anteile von weltweit ausgerichteten Fonds im Depot hatten, verloren 40,4 Prozent ihres Anlagevermögens.
Sogar die als besonders sicher geltenden Rentenfonds, die beispielsweise in staatliche Wertpapiere investieren, verzeichneten 2008 im Zuge der Finanzkrise teilweise Verluste, hieß es weiter. Bei international ausgelegten Rentenfonds verloren Anleger im Schnitt 0,4 Prozent ihres Vermögens. Normalerweise verzeichnen diese Papiere im Jahr einen Wertzuwachs im einstelligen Prozentbereich.
Tröstlich für Anleger sei im vergangenen Jahr lediglich der Blick auf die langfristige Ertragsstärke von Investmentfonds gewesen, so der BVI mit. Bei Aktienfonds mit dem Schwerpunkt Deutschland sei das Anlagevermögen über den Zeitraum von 30 Jahren im Schnitt um mehr als das Neunfache gewachsen. Wer 1978 Fondsanteile im Wert von 10.000 Euro gekauft habe, habe heute ein Vermögen von rund 92.400 Euro im Depot.
http://www.n-tv.de/1096068.html
Finanzkrise beutelt Anleger
Die Verschärfung der Finanzkrise hat Fonds-Anleger im vergangenen Jahr fast die Hälfte ihres Anlagevermögens gekostet. Investmentfonds, die in Aktien europäischer Unternehmen investieren, verloren 2008 im Schnitt 44,9 Prozent an Wert, wie der Branchenverband BVI unter Berufung auf seine aktuelle Wertentwicklungsstatistik mitteilte. Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland rutschten 2008 demnach um 43,6 Prozent ab. Investoren, die Anteile von weltweit ausgerichteten Fonds im Depot hatten, verloren 40,4 Prozent ihres Anlagevermögens.
Sogar die als besonders sicher geltenden Rentenfonds, die beispielsweise in staatliche Wertpapiere investieren, verzeichneten 2008 im Zuge der Finanzkrise teilweise Verluste, hieß es weiter. Bei international ausgelegten Rentenfonds verloren Anleger im Schnitt 0,4 Prozent ihres Vermögens. Normalerweise verzeichnen diese Papiere im Jahr einen Wertzuwachs im einstelligen Prozentbereich.
Tröstlich für Anleger sei im vergangenen Jahr lediglich der Blick auf die langfristige Ertragsstärke von Investmentfonds gewesen, so der BVI mit. Bei Aktienfonds mit dem Schwerpunkt Deutschland sei das Anlagevermögen über den Zeitraum von 30 Jahren im Schnitt um mehr als das Neunfache gewachsen. Wer 1978 Fondsanteile im Wert von 10.000 Euro gekauft habe, habe heute ein Vermögen von rund 92.400 Euro im Depot.
http://www.n-tv.de/1096068.html
Ifo-Beschäftigungsbarometer
Bau etwas besser gestimmt
von Birgit Marschall (Berlin)
Die Pläne der Bundesregierung für ein zweites Konjunkturprogramm führen offenbar zu einer leichten Verbesserung der ansonsten miserablen Stimmung unter den Arbeitgebern. Dies zeigen neue Daten des Münchner Ifo-Instituts.
Im Einzel- und Großhandel sowie im Bauhauptgewerbe hätten sich die Beschäftigungsperspektiven im Januar wieder etwas aufgehellt, meldet das Münchner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung. Dadurch sei das Ifo-Beschäftigungsbarometer für die gewerbliche Wirtschaft leicht gestiegen. In den anderen Branchen zeige sich jedoch ein Trend zum Beschäftigungsabbau.
Das Münchner Ifo-Institut befragt monatlich 7000 Unternehmen, wie ihre Beschäftigungspläne für die nächsten drei Monate aussehen. Die Unternehmen können zwischen "zunehmenden", "gleichbleibenden" oder "abnehmenden" Beschäftigtenzahlen wählen. Der Saldowert ist die Differenz der Prozentanteile der Antworten "zunehmend" und "abnehmend". Zur Berechnung der Indexwerte werden die Salden jeweils auf den Durchschnitt des Jahres 2000 normiert.
Im Januar stieg das Barometer leicht von 93,7 auf 94,4 Punkte an. Positivere Einschätzungen kamen lediglich vom Bauhauptgewerbe, das auf neue Aufträge infolge der staatlichen Konjunkturprogramme hofft. Relativ stabil zeigte sich die Beschäftigungslage auch noch im Handel. Dagegen sind derzeit in fast allen Branchen die Kapazitäten schlechter ausgelastet als noch im Herbst. Zudem hätten die Klagen über Auftragsmangel zugenommen, berichtet das Ifo-Institut. "Die Industriefirmen planen daher unverändert, den Personalbestand zu reduzieren."
http://www.ftd.de/politik/deutschland/:Ifo-Besch%E4ftigungsbarometer-Bau-etwas-besser-gestimmt/469736.html
Bau etwas besser gestimmt
von Birgit Marschall (Berlin)
Die Pläne der Bundesregierung für ein zweites Konjunkturprogramm führen offenbar zu einer leichten Verbesserung der ansonsten miserablen Stimmung unter den Arbeitgebern. Dies zeigen neue Daten des Münchner Ifo-Instituts.
Im Einzel- und Großhandel sowie im Bauhauptgewerbe hätten sich die Beschäftigungsperspektiven im Januar wieder etwas aufgehellt, meldet das Münchner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung. Dadurch sei das Ifo-Beschäftigungsbarometer für die gewerbliche Wirtschaft leicht gestiegen. In den anderen Branchen zeige sich jedoch ein Trend zum Beschäftigungsabbau.
Das Münchner Ifo-Institut befragt monatlich 7000 Unternehmen, wie ihre Beschäftigungspläne für die nächsten drei Monate aussehen. Die Unternehmen können zwischen "zunehmenden", "gleichbleibenden" oder "abnehmenden" Beschäftigtenzahlen wählen. Der Saldowert ist die Differenz der Prozentanteile der Antworten "zunehmend" und "abnehmend". Zur Berechnung der Indexwerte werden die Salden jeweils auf den Durchschnitt des Jahres 2000 normiert.
Im Januar stieg das Barometer leicht von 93,7 auf 94,4 Punkte an. Positivere Einschätzungen kamen lediglich vom Bauhauptgewerbe, das auf neue Aufträge infolge der staatlichen Konjunkturprogramme hofft. Relativ stabil zeigte sich die Beschäftigungslage auch noch im Handel. Dagegen sind derzeit in fast allen Branchen die Kapazitäten schlechter ausgelastet als noch im Herbst. Zudem hätten die Klagen über Auftragsmangel zugenommen, berichtet das Ifo-Institut. "Die Industriefirmen planen daher unverändert, den Personalbestand zu reduzieren."
http://www.ftd.de/politik/deutschland/:Ifo-Besch%E4ftigungsbarometer-Bau-etwas-besser-gestimmt/469736.html
PROTEKTIONISMUS
Welche Staaten die Weltwirtschaft abwürgen
Von Stefan Schultz
US-Präsident Obama will die Buy-American-Klausel nach internationalen Protesten stoppen - doch viele Regierungen, die jetzt vor Protektionismus warnen, betreiben diesen längst selbst. SPIEGEL ONLINE zeigt, wie der internationale Wettbewerb verzerrt wird.
Hamburg - 2009 wird ein Jahr der heftigen Einschnitte. Laut Internationalem Währungsfonds (IWF) befindet sich die Weltwirtschaft in einer tiefen Rezession, viele Länder leiden unter Nachfrageeinbrüchen, Kernindustrien fahren die Produktion zurück, Exportquoten brechen ein.
Wie schlimm die Krise wirklich ist, zeigt sich am Welthandel. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs war dieser Motor des globalen Wachstums, selbst in den großen Wirtschaftskrisen 1990 und 2001 wuchsen die globalen Exporte weiter und entfalteten dadurch eine stabilisierende Wirkung. 2009 könnte das erste Jahr der Nachkriegszeit werden, in dem der Welthandel nicht mehr wächst: Der IWF rechnet für dieses Jahr mit einem Rückgang um 2,8 Prozent.
Jetzt droht sich die Krise noch zu verschlimmern: Denn der Welthandel könnte durch neue Handelsbarrieren zusätzlich abgewürgt werden. "Harte Zeiten lösen Bestrebungen nach Protektionismus aus", sagte Pascal Lamy, Chef der Welthandelsorganisation (WTO), vergangene Woche auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos.
Die Folgen einer solchen Entwicklung sind bekannt: Als Staaten wie die USA 1929 ihre Schutzzölle erhöhten, verschlimmerte sich die Weltwirtschaftskrise zur Großen Depression. Ökonomen fürchten nun, dass sich die Geschichte wiederholen könnte - und dass durch die Krise die Globalisierung zurückgedreht werden könnte.
Sorge bereitete Ökonomen bis Dienstagnacht vor allem ein Vorschlag im US-Senat, der, sofern er umgesetzt worden wäre, wohl weltweit protektionistische Tendenzen befeuert hätte. Die von den Demokraten beherrschte Parlamentskammer hatte gefordert, dass nur Stahl und Eisen aus den USA für Infrastrukturinvestitionen aus dem neuen Konjunkturpaket der US-Regierung genutzt werden dürften. Der Senat forderte sogar, dass zusätzlich auch alle anderen Industriegüter, die im Rahmen von staatlich geförderten Projekten verwendet werden, in den USA hergestellt worden sein müssen.
In Europa und China war die Empörung groß. Europäische Stahlhersteller drängten die EU-Kommission, notfalls gegen die USA zu klagen. Der chinesische Ministerpräsident Wen Jiabao warnte vor einer neuen Protektionismus-Welle. Bundeskanzlerin Merkel forderte Obama telefonisch auf, keine protektionistischen Signale zu setzen.
Was die Protestierenden allerdings verschweigen: Auch sie selbst greifen im Angesicht der Krise längst auf staatliche Schutzprogramme zurück. Die Europäische Union will Exporthilfen für Milchprodukte wieder einführen. China subventioniert Tausende Exportgüter. Deutschland erwägt Staatskredite für Unternehmen. Die USA machen dies längst. Die Protektionisten sind längst zurück. Viele Staaten helfen mehr oder weniger verdeckt der heimischen Wirtschaft - und verzerren dadurch den internationalen Wettbewerb.
SPIEGEL ONLINE zeigt, welche Schutzprogramme Regierungen rund um den Globus ergreifen.
...
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,605304,00.html
Welche Staaten die Weltwirtschaft abwürgen
Von Stefan Schultz
US-Präsident Obama will die Buy-American-Klausel nach internationalen Protesten stoppen - doch viele Regierungen, die jetzt vor Protektionismus warnen, betreiben diesen längst selbst. SPIEGEL ONLINE zeigt, wie der internationale Wettbewerb verzerrt wird.
Hamburg - 2009 wird ein Jahr der heftigen Einschnitte. Laut Internationalem Währungsfonds (IWF) befindet sich die Weltwirtschaft in einer tiefen Rezession, viele Länder leiden unter Nachfrageeinbrüchen, Kernindustrien fahren die Produktion zurück, Exportquoten brechen ein.
Wie schlimm die Krise wirklich ist, zeigt sich am Welthandel. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs war dieser Motor des globalen Wachstums, selbst in den großen Wirtschaftskrisen 1990 und 2001 wuchsen die globalen Exporte weiter und entfalteten dadurch eine stabilisierende Wirkung. 2009 könnte das erste Jahr der Nachkriegszeit werden, in dem der Welthandel nicht mehr wächst: Der IWF rechnet für dieses Jahr mit einem Rückgang um 2,8 Prozent.
Jetzt droht sich die Krise noch zu verschlimmern: Denn der Welthandel könnte durch neue Handelsbarrieren zusätzlich abgewürgt werden. "Harte Zeiten lösen Bestrebungen nach Protektionismus aus", sagte Pascal Lamy, Chef der Welthandelsorganisation (WTO), vergangene Woche auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos.
Die Folgen einer solchen Entwicklung sind bekannt: Als Staaten wie die USA 1929 ihre Schutzzölle erhöhten, verschlimmerte sich die Weltwirtschaftskrise zur Großen Depression. Ökonomen fürchten nun, dass sich die Geschichte wiederholen könnte - und dass durch die Krise die Globalisierung zurückgedreht werden könnte.
Sorge bereitete Ökonomen bis Dienstagnacht vor allem ein Vorschlag im US-Senat, der, sofern er umgesetzt worden wäre, wohl weltweit protektionistische Tendenzen befeuert hätte. Die von den Demokraten beherrschte Parlamentskammer hatte gefordert, dass nur Stahl und Eisen aus den USA für Infrastrukturinvestitionen aus dem neuen Konjunkturpaket der US-Regierung genutzt werden dürften. Der Senat forderte sogar, dass zusätzlich auch alle anderen Industriegüter, die im Rahmen von staatlich geförderten Projekten verwendet werden, in den USA hergestellt worden sein müssen.
In Europa und China war die Empörung groß. Europäische Stahlhersteller drängten die EU-Kommission, notfalls gegen die USA zu klagen. Der chinesische Ministerpräsident Wen Jiabao warnte vor einer neuen Protektionismus-Welle. Bundeskanzlerin Merkel forderte Obama telefonisch auf, keine protektionistischen Signale zu setzen.
Was die Protestierenden allerdings verschweigen: Auch sie selbst greifen im Angesicht der Krise längst auf staatliche Schutzprogramme zurück. Die Europäische Union will Exporthilfen für Milchprodukte wieder einführen. China subventioniert Tausende Exportgüter. Deutschland erwägt Staatskredite für Unternehmen. Die USA machen dies längst. Die Protektionisten sind längst zurück. Viele Staaten helfen mehr oder weniger verdeckt der heimischen Wirtschaft - und verzerren dadurch den internationalen Wettbewerb.
SPIEGEL ONLINE zeigt, welche Schutzprogramme Regierungen rund um den Globus ergreifen.
...
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,605304,00.html
IWF, Weltbank und OECD unterstützen Merkels Charta-Pläne
BERLIN (Dow Jones)--Fünf internationale Finanz- und Wirtschaftsorganisationen unterstützen die Pläne von Bundeskanzlerin Angela Merkel für neue Regeln der Weltwirtschaft. "Wir haben uns gemeinsam dafür ausgesprochen, eine Charta für ein nachhaltiges Wirtschaften zu entwickeln", sagte Merkel am Donnerstag in Berlin nach einem Treffen mit OECD-Generalsekretär Angel Gurría, WTO-Generaldirektor Pascal Lamy, ILO-Generalsekretär Juan Somavia, dem Weltbankpräsidenten Robert Zoellick und dem Geschäftsführenden Direktor des IWF, Dominique Strauss-Kahn.
In einer gemeinsamen Erklärung betonten die Vertreter der internationalen Organisationen zusammen mit Merkel, dass die Abschwächung der weltwirtschaftlichen Entwicklung ein entschlossenes und abgestimmtes Handeln der internationalen wirtschaftspolitischen Akteure erfordere.
Die Bundeskanzlerin sprach sich für eine schnelle Umsetzung des G-20-Aktionsplanes aus. Merkel sprach sich für eine Teilnahme der Vertreter der fünf internationalen Organisationen beim G-20-Treffen im April aus.
Die Kanzlerin bezeichnete den Abschluss der Welthandels-Doha-Runde als "dringlich". Protektionismus könne keine Antwort auf die Krise sein. In der Krise dürften aber auch die Entwicklungsländer nicht aus dem Blick geraten.
IWF-Chef Strauss-Kahn sagte, es sei wichtig, dass alle zusammenarbeiteten. Daher sei die an diesem Tag angestoßene Initiative zu begrüßen. Er hoffe, dass weitere folgten. Strauss-Kahn bezeichnete die Weltwirtschaftsaussichten als "sehr schlecht oder sogar noch schlechter als das". Die sozialen Konsequenzen gerade auch auf dem Arbeitsmarkt dürften in den kommenden Monaten sehr schwierig sein, wenn nicht sogar in den kommenden Jahren.
Eine Erholung sei aber ab Anfang 2010 möglich, wenn die Regierungen mit entsprechenden Konjunkturprogrammen auf die Krise reagierten. "All das kann sich schnell verbessern, wenn all das, was mit Blick auf wirtschaftspolitische Maßnahmen getan werden muss, auch tatsächlich gemacht wird", sagte der IWF-Direktor. Die Implementierung eines Wirtschaftsstimulus in Form von Konjunkturpaketen sei Voraussetzung für eine mögliche Erholung.
Zudem müsse der Bankensektor umstrukturiert werden. Die Erholung im Bankensektor verlaufe jedoch nicht schnell genug. "Hier bin ich ein bisschen mehr besorgt; es verbessert sich auch etwas, aber es geht nicht schnell genug", sagte Strauss-Kahn. Die Erholung zu Beginn 2010 sei möglich, aber sie hänge auch von der Stärke der Bemühungen im Bankenbereich ab.
Der IWF-Chef setzte sich auch für eine Hilfe für die Länder Osteuropas ein. Es müsse den Ländern geholfen werden, die Probleme hätten. Das sei die Rolle des IWF. Dieser müsse genug Ressourcen mobilisieren.
Insgesamt sei die politische Koordination und Absprache gerade in der Krise wichtig. Das G-20-Treffen im April werde hoffentlich ein Meilenstein auf dem Weg zur Erholung sein. Das, was bisher von den Regierungen an Konjunkturpaketen auf den Weg gebracht worden sei, sei in Ordnung, sagte Strauss-Kahn. In den USA sei alles wegen des Regierungswechsels etwas langsamer gegangen.
Merkel wie auch Lamy bewerteten die Änderung des "Buy America"-Artikels durch den US-Senat als gutes Signal. Dies sei eine sensible Reaktion auf die Kritik gewesen, sagte Lamy. Merkel betonte, Abschottung in der Krise sei kein Weg. Die Subventionierung der US-Autokonzerne jedoch "macht mir Sorge", sagte die Kanzlerin.
BERLIN (Dow Jones)--Fünf internationale Finanz- und Wirtschaftsorganisationen unterstützen die Pläne von Bundeskanzlerin Angela Merkel für neue Regeln der Weltwirtschaft. "Wir haben uns gemeinsam dafür ausgesprochen, eine Charta für ein nachhaltiges Wirtschaften zu entwickeln", sagte Merkel am Donnerstag in Berlin nach einem Treffen mit OECD-Generalsekretär Angel Gurría, WTO-Generaldirektor Pascal Lamy, ILO-Generalsekretär Juan Somavia, dem Weltbankpräsidenten Robert Zoellick und dem Geschäftsführenden Direktor des IWF, Dominique Strauss-Kahn.
In einer gemeinsamen Erklärung betonten die Vertreter der internationalen Organisationen zusammen mit Merkel, dass die Abschwächung der weltwirtschaftlichen Entwicklung ein entschlossenes und abgestimmtes Handeln der internationalen wirtschaftspolitischen Akteure erfordere.
Die Bundeskanzlerin sprach sich für eine schnelle Umsetzung des G-20-Aktionsplanes aus. Merkel sprach sich für eine Teilnahme der Vertreter der fünf internationalen Organisationen beim G-20-Treffen im April aus.
Die Kanzlerin bezeichnete den Abschluss der Welthandels-Doha-Runde als "dringlich". Protektionismus könne keine Antwort auf die Krise sein. In der Krise dürften aber auch die Entwicklungsländer nicht aus dem Blick geraten.
IWF-Chef Strauss-Kahn sagte, es sei wichtig, dass alle zusammenarbeiteten. Daher sei die an diesem Tag angestoßene Initiative zu begrüßen. Er hoffe, dass weitere folgten. Strauss-Kahn bezeichnete die Weltwirtschaftsaussichten als "sehr schlecht oder sogar noch schlechter als das". Die sozialen Konsequenzen gerade auch auf dem Arbeitsmarkt dürften in den kommenden Monaten sehr schwierig sein, wenn nicht sogar in den kommenden Jahren.
Eine Erholung sei aber ab Anfang 2010 möglich, wenn die Regierungen mit entsprechenden Konjunkturprogrammen auf die Krise reagierten. "All das kann sich schnell verbessern, wenn all das, was mit Blick auf wirtschaftspolitische Maßnahmen getan werden muss, auch tatsächlich gemacht wird", sagte der IWF-Direktor. Die Implementierung eines Wirtschaftsstimulus in Form von Konjunkturpaketen sei Voraussetzung für eine mögliche Erholung.
Zudem müsse der Bankensektor umstrukturiert werden. Die Erholung im Bankensektor verlaufe jedoch nicht schnell genug. "Hier bin ich ein bisschen mehr besorgt; es verbessert sich auch etwas, aber es geht nicht schnell genug", sagte Strauss-Kahn. Die Erholung zu Beginn 2010 sei möglich, aber sie hänge auch von der Stärke der Bemühungen im Bankenbereich ab.
Der IWF-Chef setzte sich auch für eine Hilfe für die Länder Osteuropas ein. Es müsse den Ländern geholfen werden, die Probleme hätten. Das sei die Rolle des IWF. Dieser müsse genug Ressourcen mobilisieren.
Insgesamt sei die politische Koordination und Absprache gerade in der Krise wichtig. Das G-20-Treffen im April werde hoffentlich ein Meilenstein auf dem Weg zur Erholung sein. Das, was bisher von den Regierungen an Konjunkturpaketen auf den Weg gebracht worden sei, sei in Ordnung, sagte Strauss-Kahn. In den USA sei alles wegen des Regierungswechsels etwas langsamer gegangen.
Merkel wie auch Lamy bewerteten die Änderung des "Buy America"-Artikels durch den US-Senat als gutes Signal. Dies sei eine sensible Reaktion auf die Kritik gewesen, sagte Lamy. Merkel betonte, Abschottung in der Krise sei kein Weg. Die Subventionierung der US-Autokonzerne jedoch "macht mir Sorge", sagte die Kanzlerin.
Kürzlich auf WSJ
http://online.wsj.com/article/SB123051100709638419.html

* DECEMBER 29, 2008
As if Things Weren't Bad Enough, Russian Professor Predicts End of U.S.
In Moscow, Igor Panarin's Forecasts Are All the Rage; America 'Disintegrates' in 2010
By ANDREW OSBORN
MOSCOW -- For a decade, Russian academic Igor Panarin has been predicting the U.S. will fall apart in 2010. For most of that time, he admits, few took his argument -- that an economic and moral collapse will trigger a civil war and the eventual breakup of the U.S. -- very seriously. Now he's found an eager audience: Russian state media.
In recent weeks, he's been interviewed as much as twice a day about his predictions. "It's a record," says Prof. Panarin. "But I think the attention is going to grow even stronger."
Prof. Panarin, 50 years old, is not a fringe figure. A former KGB analyst, he is dean of the Russian Foreign Ministry's academy for future diplomats. He is invited to Kremlin receptions, lectures students, publishes books, and appears in the media as an expert on U.S.-Russia relations.
But it's his bleak forecast for the U.S. that is music to the ears of the Kremlin, which in recent years has blamed Washington for everything from instability in the Middle East to the global financial crisis. Mr. Panarin's views also fit neatly with the Kremlin's narrative that Russia is returning to its rightful place on the world stage after the weakness of the 1990s, when many feared that the country would go economically and politically bankrupt and break into separate territories.
A polite and cheerful man with a buzz cut, Mr. Panarin insists he does not dislike Americans. But he warns that the outlook for them is dire.
"There's a 55-45% chance right now that disintegration will occur," he says. "One could rejoice in that process," he adds, poker-faced. "But if we're talking reasonably, it's not the best scenario -- for Russia." Though Russia would become more powerful on the global stage, he says, its economy would suffer because it currently depends heavily on the dollar and on trade with the U.S.
Mr. Panarin posits, in brief, that mass immigration, economic decline, and moral degradation will trigger a civil war next fall and the collapse of the dollar. Around the end of June 2010, or early July, he says, the U.S. will break into six pieces -- with Alaska reverting to Russian control.
In addition to increasing coverage in state media, which are tightly controlled by the Kremlin, Mr. Panarin's ideas are now being widely discussed among local experts. He presented his theory at a recent roundtable discussion at the Foreign Ministry. The country's top international relations school has hosted him as a keynote speaker. During an appearance on the state TV channel Rossiya, the station cut between his comments and TV footage of lines at soup kitchens and crowds of homeless people in the U.S. The professor has also been featured on the Kremlin's English-language propaganda channel, Russia Today.
Mr. Panarin's apocalyptic vision "reflects a very pronounced degree of anti-Americanism in Russia today," says Vladimir Pozner, a prominent TV journalist in Russia. "It's much stronger than it was in the Soviet Union."
Mr. Pozner and other Russian commentators and experts on the U.S. dismiss Mr. Panarin's predictions. "Crazy ideas are not usually discussed by serious people," says Sergei Rogov, director of the government-run Institute for U.S. and Canadian Studies, who thinks Mr. Panarin's theories don't hold water.
Mr. Panarin's résumé includes many years in the Soviet KGB, an experience shared by other top Russian officials. His office, in downtown Moscow, shows his national pride, with pennants on the wall bearing the emblem of the FSB, the KGB's successor agency. It is also full of statuettes of eagles; a double-headed eagle was the symbol of czarist Russia.
The professor says he began his career in the KGB in 1976. In post-Soviet Russia, he got a doctorate in political science, studied U.S. economics, and worked for FAPSI, then the Russian equivalent of the U.S. National Security Agency. He says he did strategy forecasts for then-President Boris Yeltsin, adding that the details are "classified."
In September 1998, he attended a conference in Linz, Austria, devoted to information warfare, the use of data to get an edge over a rival. It was there, in front of 400 fellow delegates, that he first presented his theory about the collapse of the U.S. in 2010.
"When I pushed the button on my computer and the map of the United States disintegrated, hundreds of people cried out in surprise," he remembers. He says most in the audience were skeptical. "They didn't believe me."
At the end of the presentation, he says many delegates asked him to autograph copies of the map showing a dismembered U.S.
He based the forecast on classified data supplied to him by FAPSI analysts, he says. He predicts that economic, financial and demographic trends will provoke a political and social crisis in the U.S. When the going gets tough, he says, wealthier states will withhold funds from the federal government and effectively secede from the union. Social unrest up to and including a civil war will follow. The U.S. will then split along ethnic lines, and foreign powers will move in.
California will form the nucleus of what he calls "The Californian Republic," and will be part of China or under Chinese influence. Texas will be the heart of "The Texas Republic," a cluster of states that will go to Mexico or fall under Mexican influence. Washington, D.C., and New York will be part of an "Atlantic America" that may join the European Union. Canada will grab a group of Northern states Prof. Panarin calls "The Central North American Republic." Hawaii, he suggests, will be a protectorate of Japan or China, and Alaska will be subsumed into Russia.
"It would be reasonable for Russia to lay claim to Alaska; it was part of the Russian Empire for a long time." A framed satellite image of the Bering Strait that separates Alaska from Russia like a thread hangs from his office wall. "It's not there for no reason," he says with a sly grin.
Interest in his forecast revived this fall when he published an article in Izvestia, one of Russia's biggest national dailies. In it, he reiterated his theory, called U.S. foreign debt "a pyramid scheme," and predicted China and Russia would usurp Washington's role as a global financial regulator.
Americans hope President-elect Barack Obama "can work miracles," he wrote. "But when spring comes, it will be clear that there are no miracles."
The article prompted a question about the White House's reaction to Prof. Panarin's forecast at a December news conference. "I'll have to decline to comment," spokeswoman Dana Perino said amid much laughter.
For Prof. Panarin, Ms. Perino's response was significant. "The way the answer was phrased was an indication that my views are being listened to very carefully," he says.
The professor says he's convinced that people are taking his theory more seriously. People like him have forecast similar cataclysms before, he says, and been right. He cites French political scientist Emmanuel Todd. Mr. Todd is famous for having rightly forecast the demise of the Soviet Union -- 15 years beforehand. "When he forecast the collapse of the Soviet Union in 1976, people laughed at him," says Prof. Panarin.
http://online.wsj.com/article/SB123051100709638419.html

* DECEMBER 29, 2008
As if Things Weren't Bad Enough, Russian Professor Predicts End of U.S.
In Moscow, Igor Panarin's Forecasts Are All the Rage; America 'Disintegrates' in 2010
By ANDREW OSBORN
MOSCOW -- For a decade, Russian academic Igor Panarin has been predicting the U.S. will fall apart in 2010. For most of that time, he admits, few took his argument -- that an economic and moral collapse will trigger a civil war and the eventual breakup of the U.S. -- very seriously. Now he's found an eager audience: Russian state media.
In recent weeks, he's been interviewed as much as twice a day about his predictions. "It's a record," says Prof. Panarin. "But I think the attention is going to grow even stronger."
Prof. Panarin, 50 years old, is not a fringe figure. A former KGB analyst, he is dean of the Russian Foreign Ministry's academy for future diplomats. He is invited to Kremlin receptions, lectures students, publishes books, and appears in the media as an expert on U.S.-Russia relations.
But it's his bleak forecast for the U.S. that is music to the ears of the Kremlin, which in recent years has blamed Washington for everything from instability in the Middle East to the global financial crisis. Mr. Panarin's views also fit neatly with the Kremlin's narrative that Russia is returning to its rightful place on the world stage after the weakness of the 1990s, when many feared that the country would go economically and politically bankrupt and break into separate territories.
A polite and cheerful man with a buzz cut, Mr. Panarin insists he does not dislike Americans. But he warns that the outlook for them is dire.
"There's a 55-45% chance right now that disintegration will occur," he says. "One could rejoice in that process," he adds, poker-faced. "But if we're talking reasonably, it's not the best scenario -- for Russia." Though Russia would become more powerful on the global stage, he says, its economy would suffer because it currently depends heavily on the dollar and on trade with the U.S.
Mr. Panarin posits, in brief, that mass immigration, economic decline, and moral degradation will trigger a civil war next fall and the collapse of the dollar. Around the end of June 2010, or early July, he says, the U.S. will break into six pieces -- with Alaska reverting to Russian control.
In addition to increasing coverage in state media, which are tightly controlled by the Kremlin, Mr. Panarin's ideas are now being widely discussed among local experts. He presented his theory at a recent roundtable discussion at the Foreign Ministry. The country's top international relations school has hosted him as a keynote speaker. During an appearance on the state TV channel Rossiya, the station cut between his comments and TV footage of lines at soup kitchens and crowds of homeless people in the U.S. The professor has also been featured on the Kremlin's English-language propaganda channel, Russia Today.
Mr. Panarin's apocalyptic vision "reflects a very pronounced degree of anti-Americanism in Russia today," says Vladimir Pozner, a prominent TV journalist in Russia. "It's much stronger than it was in the Soviet Union."
Mr. Pozner and other Russian commentators and experts on the U.S. dismiss Mr. Panarin's predictions. "Crazy ideas are not usually discussed by serious people," says Sergei Rogov, director of the government-run Institute for U.S. and Canadian Studies, who thinks Mr. Panarin's theories don't hold water.
Mr. Panarin's résumé includes many years in the Soviet KGB, an experience shared by other top Russian officials. His office, in downtown Moscow, shows his national pride, with pennants on the wall bearing the emblem of the FSB, the KGB's successor agency. It is also full of statuettes of eagles; a double-headed eagle was the symbol of czarist Russia.
The professor says he began his career in the KGB in 1976. In post-Soviet Russia, he got a doctorate in political science, studied U.S. economics, and worked for FAPSI, then the Russian equivalent of the U.S. National Security Agency. He says he did strategy forecasts for then-President Boris Yeltsin, adding that the details are "classified."
In September 1998, he attended a conference in Linz, Austria, devoted to information warfare, the use of data to get an edge over a rival. It was there, in front of 400 fellow delegates, that he first presented his theory about the collapse of the U.S. in 2010.
"When I pushed the button on my computer and the map of the United States disintegrated, hundreds of people cried out in surprise," he remembers. He says most in the audience were skeptical. "They didn't believe me."
At the end of the presentation, he says many delegates asked him to autograph copies of the map showing a dismembered U.S.
He based the forecast on classified data supplied to him by FAPSI analysts, he says. He predicts that economic, financial and demographic trends will provoke a political and social crisis in the U.S. When the going gets tough, he says, wealthier states will withhold funds from the federal government and effectively secede from the union. Social unrest up to and including a civil war will follow. The U.S. will then split along ethnic lines, and foreign powers will move in.
California will form the nucleus of what he calls "The Californian Republic," and will be part of China or under Chinese influence. Texas will be the heart of "The Texas Republic," a cluster of states that will go to Mexico or fall under Mexican influence. Washington, D.C., and New York will be part of an "Atlantic America" that may join the European Union. Canada will grab a group of Northern states Prof. Panarin calls "The Central North American Republic." Hawaii, he suggests, will be a protectorate of Japan or China, and Alaska will be subsumed into Russia.
"It would be reasonable for Russia to lay claim to Alaska; it was part of the Russian Empire for a long time." A framed satellite image of the Bering Strait that separates Alaska from Russia like a thread hangs from his office wall. "It's not there for no reason," he says with a sly grin.
Interest in his forecast revived this fall when he published an article in Izvestia, one of Russia's biggest national dailies. In it, he reiterated his theory, called U.S. foreign debt "a pyramid scheme," and predicted China and Russia would usurp Washington's role as a global financial regulator.
Americans hope President-elect Barack Obama "can work miracles," he wrote. "But when spring comes, it will be clear that there are no miracles."
The article prompted a question about the White House's reaction to Prof. Panarin's forecast at a December news conference. "I'll have to decline to comment," spokeswoman Dana Perino said amid much laughter.
For Prof. Panarin, Ms. Perino's response was significant. "The way the answer was phrased was an indication that my views are being listened to very carefully," he says.
The professor says he's convinced that people are taking his theory more seriously. People like him have forecast similar cataclysms before, he says, and been right. He cites French political scientist Emmanuel Todd. Mr. Todd is famous for having rightly forecast the demise of the Soviet Union -- 15 years beforehand. "When he forecast the collapse of the Soviet Union in 1976, people laughed at him," says Prof. Panarin.
[url=http://peketec.de/trading/viewtopic.php?p=593939#593939 schrieb:corwin schrieb am 10.02.2009, 08:48 Uhr[/url]"]na das könnte noch interessant werden
Bricht die USA auseinander?
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2009/02/bricht-die-usa-auseinander.html
edit: muss cih wohl doch noch nach bayern ziehen

http://de.statista.com/statistik/da...he-pro-kopf-verschuldung-nach-bundeslaendern/
REZESSION
Maschinenbau erwartet drastischen Produktionsrückgang
Die Wirtschaftskrise trifft den Maschinenbau mit voller Wucht: In der deutschen Schlüsselindustrie wird 2009 erstmals seit Jahren ein deutlicher Produktionsrückgang befürchtet - um satte sieben Prozent. 25.000 Jobs sind bedroht, teilte der Branchenverband mit.
Frankfurt am Main - Gegen Ende des Jahres 2008 brachen die Bestellungen massiv ein. Angesichts dessen revidierte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Dienstag in Frankfurt seine Prognose für 2009. Die Branche rechnet nun mit einem Rückgang der Produktion um sieben Prozent, nachdem bislang ein stabiler Verlauf erwartet worden war.
...
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,606622,00.html
Maschinenbau erwartet drastischen Produktionsrückgang
Die Wirtschaftskrise trifft den Maschinenbau mit voller Wucht: In der deutschen Schlüsselindustrie wird 2009 erstmals seit Jahren ein deutlicher Produktionsrückgang befürchtet - um satte sieben Prozent. 25.000 Jobs sind bedroht, teilte der Branchenverband mit.
Frankfurt am Main - Gegen Ende des Jahres 2008 brachen die Bestellungen massiv ein. Angesichts dessen revidierte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Dienstag in Frankfurt seine Prognose für 2009. Die Branche rechnet nun mit einem Rückgang der Produktion um sieben Prozent, nachdem bislang ein stabiler Verlauf erwartet worden war.
...
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,606622,00.html
US-Firmen stehen drauf, Standort D ist spitze!

Deutschland hat als Investitionsstandort von US-Unternehmen den Spitzenplatz in Europa erobert. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Amerikanischen Handelskammer in Deutschland und der Managementberatung Boston Consulting Group (BCG).
Die Bundesrepublik lag in der zum sechsten Mal vorgelegten Studie erstmals vor der Region Osteuropa. "Deutschland wird jetzt in der Krise als Nummer eins gesehen", sagte BCG-Deutschland-Chef Christian Veith. Ende 2008 wurden 61 US-Firmen mit einem Jahresumsatz von 110 Mrd. Euro und rund 250.000 Mitarbeitern in Deutschland befragt.
In der Wirtschaftskrise gewönnen Faktoren wie Zuverlässigkeit in der Produktion und eine gute Infrastruktur an Bedeutung, sagte Veith. Standortnachteile gegenüber Osteuropa wie hohe Personalkosten würden als nicht mehr so wichtig angesehen.
Immerhin ein Drittel (32 Prozent) der befragten US-Firmen will 2009 die Investitionen in Deutschland erhöhen. Die Hälfte (51 Prozent) will etwa so viel investieren wie 2008.
Stabiles Image
Deutschland gilt immer noch als "ein äußerst attraktiver Markt", sagte AmCham-Präsident Fred B. Irwin. Als Gründe würden der verhältnismäßig stabile Immobilienmarkt, die hohe Kaufkraft und die geringe Verschuldung der Privathaushalte genannt. Zudem seien ein Drittel der befragten US-Firmen überzeugt, dass die Auswirkungen der Finanzkrise in Deutschland weniger stark zu spüren seien als in anderen Ländern, sagte Irwin.
Größte Standortschwäche Deutschlands ist aus US-Sicht inzwischen der Mangel an qualifizierten Nachwuchskräften. "Das Thema darf in der Hektik der Wirtschaftskrise nicht vernachlässigt werden", sagte Veith.
http://www.n-tv.de/1100572.html

Deutschland hat als Investitionsstandort von US-Unternehmen den Spitzenplatz in Europa erobert. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Amerikanischen Handelskammer in Deutschland und der Managementberatung Boston Consulting Group (BCG).
Die Bundesrepublik lag in der zum sechsten Mal vorgelegten Studie erstmals vor der Region Osteuropa. "Deutschland wird jetzt in der Krise als Nummer eins gesehen", sagte BCG-Deutschland-Chef Christian Veith. Ende 2008 wurden 61 US-Firmen mit einem Jahresumsatz von 110 Mrd. Euro und rund 250.000 Mitarbeitern in Deutschland befragt.
In der Wirtschaftskrise gewönnen Faktoren wie Zuverlässigkeit in der Produktion und eine gute Infrastruktur an Bedeutung, sagte Veith. Standortnachteile gegenüber Osteuropa wie hohe Personalkosten würden als nicht mehr so wichtig angesehen.
Immerhin ein Drittel (32 Prozent) der befragten US-Firmen will 2009 die Investitionen in Deutschland erhöhen. Die Hälfte (51 Prozent) will etwa so viel investieren wie 2008.
Stabiles Image
Deutschland gilt immer noch als "ein äußerst attraktiver Markt", sagte AmCham-Präsident Fred B. Irwin. Als Gründe würden der verhältnismäßig stabile Immobilienmarkt, die hohe Kaufkraft und die geringe Verschuldung der Privathaushalte genannt. Zudem seien ein Drittel der befragten US-Firmen überzeugt, dass die Auswirkungen der Finanzkrise in Deutschland weniger stark zu spüren seien als in anderen Ländern, sagte Irwin.
Größte Standortschwäche Deutschlands ist aus US-Sicht inzwischen der Mangel an qualifizierten Nachwuchskräften. "Das Thema darf in der Hektik der Wirtschaftskrise nicht vernachlässigt werden", sagte Veith.
http://www.n-tv.de/1100572.html
Beängstigende Prognose - Deutschland droht Inflation bis zu zehn Prozent
Wirtschaftsforscher Thomas Straubhaar erwartet in Kürze eine kräftige Geldentwertung. Für die Zeit nach 2010 rechnet er mit einer Inflation zwischen fünf und zehn Prozent pro Jahr. Schon dieses Jahr würden die Energiepreise wieder kräftig anziehen, prognostiziert er. Damit würde sich der derzeitige Trend völlig umkehren.
[...]
http://www.welt.de/wirtschaft/article3238343/Deutschland-droht-Inflation-bis-zu-zehn-Prozent.html
Wirtschaftsforscher Thomas Straubhaar erwartet in Kürze eine kräftige Geldentwertung. Für die Zeit nach 2010 rechnet er mit einer Inflation zwischen fünf und zehn Prozent pro Jahr. Schon dieses Jahr würden die Energiepreise wieder kräftig anziehen, prognostiziert er. Damit würde sich der derzeitige Trend völlig umkehren.
[...]
http://www.welt.de/wirtschaft/article3238343/Deutschland-droht-Inflation-bis-zu-zehn-Prozent.html
Also die heute mal so und morgen mal so "Die Welt" ist ja fast euphorisch 
Rezession
Ist das Ende der Wirtschaftskrise schon in Sicht?
22. Februar 2009, 12:35 Uhr
Mitten in der schwersten Krise der Nachkriegszeit gibt es Anlass zur Hoffnung. Erste Indikatoren wie ZEW- und Ifo-Index und deuten an: Der Tiefpunkt des Konjunkturzyklus könnte schon bald erreicht sein. Ein zumindest zaghafter Aufschwung in der zweiten Jahreshälfte ist möglich.
Tunnel

Ist schon Licht am Ende des Tunnels? Erste Indikatoren geben Anlass zur Hoffnung
oder so

Fast klang es so, als wollte sich Dieter Zetsche selbst Mut machen. Zwar ist Daimler in den ersten Wochen des Jahres in die roten Zahlen gerutscht. Doch Zetsche, der Chef des Stuttgarter Autoherstellers, geht davon aus, "dass sich die Ergebnisse schrittweise von Quartal zu Quartal verbessern". Im zweiten Halbjahr könne die Talsohle durchschritten sein, hofft der Manager.
Das zweite Halbjahr 2009: Schon seit dem Herbst ist häufiger von Politikern und Wirtschaftsführern zu hören, dass dann der Aufschwung kommt. Nur war das eher eine vage Hoffnung als eine Prognose. Denn noch vor wenigen Wochen zeigten alle Indikatoren für die konjunkturelle Entwicklung in nur eine Richtung: nach unten.
Inzwischen aber deutet sich an: Die ersehnte wirtschaftliche Stabilisierung im Jahresverlauf könnte sich tatsächlich einstellen, eine ganze Reihe von Indikatoren und anderen Indizien sprechen mittlerweile dafür. "Die Rezession setzt sich fort, aber wir sehen Licht am Ende des Tunnels", sagt Andreas Rees, Chefvolkswirt Deutschland bei Unicredit. Auch Michael Hüther, Direktor am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW), ist vorsichtig optimistisch: Deutschland werde zwar nur langsam aus der Krise "herauskriechen", so der Ökonom. "Doch es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn es weiter so steil bergab geht. Ich gehe davon aus, dass wir die Talsohle der Rezession im Sommer erreichen werden."
Noch kann niemand sicher sein, ob es wirklich so kommt. Noch ist die Mehrheit der Nachrichten, die Unternehmenszentralen und Statistikämtern veröffentlichen, beängstigend. Und keiner weiß, ob vom Bankensystem in den kommenden Monaten nicht noch größere Schockwellen ausgehen werden als ohnehin schon. Die Stimmung unter den Experten hat sich dennoch bereits merklich gedreht, die Hoffnung auf ein Ende der Abwärtsspirale, beobachtet Unicredit-Experte Rees, ist in der Fachwelt "in aller Munde".
Auch bei den Finanzanalysten, die das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) monatlich nach ihren Konjunkturerwartungen befragt.
Vorige Woche sprang der entsprechende ZEW-Index überraschend stark nach oben - und zwar schon zum vierten Mal in Folge. Die Verbesserung ist also kein einmaliger Ausreißer mehr.
Der Sechs-Monats-Durchschnitt des Indexes zeigt denn auch aufwärts - nach Auffassung von Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank, ein wichtiges Signal: "Im Regelfall folgt darauf vier bis fünf Monate später das Ende der Rezession."
Nach unten gedrückt wird das Wachstum in diesem Jahr fraglos vom Auslandsgeschäft, der Außenhandelsverband BGA rechnet für 2009 mit einem Exporteinbruch von bis zu acht Prozent. Aber immerhin deutet sich eine Stabilisierung an.
Der Baltic-Dry-Index (BDI), der die Frachtpreise von Containerschiffen erfasst, war bis zum Dezember drastisch eingebrochen - und steigt nun von niedrigem Niveau aus wieder deutlich an.
Hoffen lässt die Ökonomen der Verbraucher. In den USA könnte sich der private Konsum stabilisieren - im Januar jedenfalls legten die amerikanischen Einzelhandelsumsätze ganz entgegen der Analystenprognosen zu.
Und in Deutschland schlagen sich die eigentlich selbst in konjunkturell guten Zeiten notorisch schlecht gelaunten Verbraucher wacker. Die Tariflöhne sind im vergangenen Jahr so stark gestiegen wie seit zwölf Jahren nicht mehr. Tanken und Heizen ist wegen des niedrigeren Ölpreises wieder deutlich günstiger.
Und im Konjunkturpaket der Bundesregierung sind neben Abwrackprämie und einmaligem Kinderbonus weitere Maßnahmen enthalten, um Verbraucher finanziell zu unterstützen. Rolf Bürkel von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) rechnet daher immerhin mit einem leichten Plus von 0,5 Prozent in diesem Jahr: "Das wird nicht reichen, um den Rückgang im Export auszugleichen, aber der Konsum wird die Konjunktur wenigstens stützen."

Übersicht: Ifo-Erwartungen und ZEW-Index
Viel hängt davon ab, wie stark die Arbeitslosigkeit im Zuge der Krise nach oben schnellen wird. Nicht zuletzt wegen des drohenden Fachkräftemangels versuchen Unternehmen mittlerweile, ihre Mitarbeiter solange wie möglich zu halten. Roland Döhrn vom Rheinisch Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) erwartet, dass in diesem Jahr 600 000 Arbeitslose dazukommen. Da viele Firmen versuchen, die Krise durch Kurzarbeit zu überbrücken, ist noch nicht einmal sicher, ob die Marke von vier Millionen überschritten wird, von alten Höchstständen Mitte des Jahrzehnts bliebe Deutschland bis auf Weiteres weit entfernt.
Bei den Unternehmen selbst ist zwar mehrheitlich von Optimismus wenig zu spüren. Aber das Hier und Jetzt wird gar nicht so schlecht eingeschätzt, wie es die amtlichen Statistiken nahelegen. Der Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo-Instituts zum Beispiel ist im Januar erstmals seit Mai vergangenen Jahres wieder gestiegen.
Bei erstaunlich vielen Unternehmen hat die Krise ohnedies noch gar nicht so richtig zugeschlagen, ergab eine gerade veröffentlichte Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Immerhin drei von vier Firmen schätzen demnach ihre eigene Geschäftslage als befriedigend oder gar gut ein. Selbst die Finanzierungsbedingungen haben sich trotz Finanzkrise für fast 80 Prozent der Unternehmen nicht verschlechtert. Der Schuh drückt woanders. Im Januar klagten nach einer Ifo-Umfrage so viele Unternehmen wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr über zu volle Lager.
Was aber momentan ein Symptom für die Krise ist, wird der Wirtschaft helfen, sobald die Nachfrage wieder anzieht. Dank ihrer hohen Bestände können Unternehmen Kundenwünsche dann schnell und kostengünstig bedienen. "An einem konjunkturellen Wendepunkt", sagt Commerzbank-Ökonom Krämer, "wirkt das wie Dynamit."
Rezession
Ist das Ende der Wirtschaftskrise schon in Sicht?
22. Februar 2009, 12:35 Uhr
Mitten in der schwersten Krise der Nachkriegszeit gibt es Anlass zur Hoffnung. Erste Indikatoren wie ZEW- und Ifo-Index und deuten an: Der Tiefpunkt des Konjunkturzyklus könnte schon bald erreicht sein. Ein zumindest zaghafter Aufschwung in der zweiten Jahreshälfte ist möglich.
Tunnel

Ist schon Licht am Ende des Tunnels? Erste Indikatoren geben Anlass zur Hoffnung
oder so

Fast klang es so, als wollte sich Dieter Zetsche selbst Mut machen. Zwar ist Daimler in den ersten Wochen des Jahres in die roten Zahlen gerutscht. Doch Zetsche, der Chef des Stuttgarter Autoherstellers, geht davon aus, "dass sich die Ergebnisse schrittweise von Quartal zu Quartal verbessern". Im zweiten Halbjahr könne die Talsohle durchschritten sein, hofft der Manager.
Das zweite Halbjahr 2009: Schon seit dem Herbst ist häufiger von Politikern und Wirtschaftsführern zu hören, dass dann der Aufschwung kommt. Nur war das eher eine vage Hoffnung als eine Prognose. Denn noch vor wenigen Wochen zeigten alle Indikatoren für die konjunkturelle Entwicklung in nur eine Richtung: nach unten.
Inzwischen aber deutet sich an: Die ersehnte wirtschaftliche Stabilisierung im Jahresverlauf könnte sich tatsächlich einstellen, eine ganze Reihe von Indikatoren und anderen Indizien sprechen mittlerweile dafür. "Die Rezession setzt sich fort, aber wir sehen Licht am Ende des Tunnels", sagt Andreas Rees, Chefvolkswirt Deutschland bei Unicredit. Auch Michael Hüther, Direktor am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW), ist vorsichtig optimistisch: Deutschland werde zwar nur langsam aus der Krise "herauskriechen", so der Ökonom. "Doch es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn es weiter so steil bergab geht. Ich gehe davon aus, dass wir die Talsohle der Rezession im Sommer erreichen werden."
Noch kann niemand sicher sein, ob es wirklich so kommt. Noch ist die Mehrheit der Nachrichten, die Unternehmenszentralen und Statistikämtern veröffentlichen, beängstigend. Und keiner weiß, ob vom Bankensystem in den kommenden Monaten nicht noch größere Schockwellen ausgehen werden als ohnehin schon. Die Stimmung unter den Experten hat sich dennoch bereits merklich gedreht, die Hoffnung auf ein Ende der Abwärtsspirale, beobachtet Unicredit-Experte Rees, ist in der Fachwelt "in aller Munde".
Auch bei den Finanzanalysten, die das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) monatlich nach ihren Konjunkturerwartungen befragt.
Vorige Woche sprang der entsprechende ZEW-Index überraschend stark nach oben - und zwar schon zum vierten Mal in Folge. Die Verbesserung ist also kein einmaliger Ausreißer mehr.
Der Sechs-Monats-Durchschnitt des Indexes zeigt denn auch aufwärts - nach Auffassung von Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank, ein wichtiges Signal: "Im Regelfall folgt darauf vier bis fünf Monate später das Ende der Rezession."
Nach unten gedrückt wird das Wachstum in diesem Jahr fraglos vom Auslandsgeschäft, der Außenhandelsverband BGA rechnet für 2009 mit einem Exporteinbruch von bis zu acht Prozent. Aber immerhin deutet sich eine Stabilisierung an.
Der Baltic-Dry-Index (BDI), der die Frachtpreise von Containerschiffen erfasst, war bis zum Dezember drastisch eingebrochen - und steigt nun von niedrigem Niveau aus wieder deutlich an.
Hoffen lässt die Ökonomen der Verbraucher. In den USA könnte sich der private Konsum stabilisieren - im Januar jedenfalls legten die amerikanischen Einzelhandelsumsätze ganz entgegen der Analystenprognosen zu.
Und in Deutschland schlagen sich die eigentlich selbst in konjunkturell guten Zeiten notorisch schlecht gelaunten Verbraucher wacker. Die Tariflöhne sind im vergangenen Jahr so stark gestiegen wie seit zwölf Jahren nicht mehr. Tanken und Heizen ist wegen des niedrigeren Ölpreises wieder deutlich günstiger.
Und im Konjunkturpaket der Bundesregierung sind neben Abwrackprämie und einmaligem Kinderbonus weitere Maßnahmen enthalten, um Verbraucher finanziell zu unterstützen. Rolf Bürkel von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) rechnet daher immerhin mit einem leichten Plus von 0,5 Prozent in diesem Jahr: "Das wird nicht reichen, um den Rückgang im Export auszugleichen, aber der Konsum wird die Konjunktur wenigstens stützen."

Übersicht: Ifo-Erwartungen und ZEW-Index
Viel hängt davon ab, wie stark die Arbeitslosigkeit im Zuge der Krise nach oben schnellen wird. Nicht zuletzt wegen des drohenden Fachkräftemangels versuchen Unternehmen mittlerweile, ihre Mitarbeiter solange wie möglich zu halten. Roland Döhrn vom Rheinisch Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) erwartet, dass in diesem Jahr 600 000 Arbeitslose dazukommen. Da viele Firmen versuchen, die Krise durch Kurzarbeit zu überbrücken, ist noch nicht einmal sicher, ob die Marke von vier Millionen überschritten wird, von alten Höchstständen Mitte des Jahrzehnts bliebe Deutschland bis auf Weiteres weit entfernt.
Bei den Unternehmen selbst ist zwar mehrheitlich von Optimismus wenig zu spüren. Aber das Hier und Jetzt wird gar nicht so schlecht eingeschätzt, wie es die amtlichen Statistiken nahelegen. Der Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo-Instituts zum Beispiel ist im Januar erstmals seit Mai vergangenen Jahres wieder gestiegen.
Bei erstaunlich vielen Unternehmen hat die Krise ohnedies noch gar nicht so richtig zugeschlagen, ergab eine gerade veröffentlichte Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Immerhin drei von vier Firmen schätzen demnach ihre eigene Geschäftslage als befriedigend oder gar gut ein. Selbst die Finanzierungsbedingungen haben sich trotz Finanzkrise für fast 80 Prozent der Unternehmen nicht verschlechtert. Der Schuh drückt woanders. Im Januar klagten nach einer Ifo-Umfrage so viele Unternehmen wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr über zu volle Lager.
Was aber momentan ein Symptom für die Krise ist, wird der Wirtschaft helfen, sobald die Nachfrage wieder anzieht. Dank ihrer hohen Bestände können Unternehmen Kundenwünsche dann schnell und kostengünstig bedienen. "An einem konjunkturellen Wendepunkt", sagt Commerzbank-Ökonom Krämer, "wirkt das wie Dynamit."
Erhaltung von Jobs
Familienfirmen kämpfen
Die Familienunternehmer in Deutschland versuchen, auch in der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise Arbeitsplätze zu erhalten. In einer Umfrage der Verbände der Familienunternehmer und der Jungen Unternehmer unter 512 Unternehmern gaben knapp 60 Prozent der Befragten an, in den nächsten sechs Monaten die Zahl ihrer Mitarbeiter konstant halten zu wollen. Rund 16 Prozent wollen neue Arbeitsplätze schaffen. Knapp 24 Prozent gehen dagegen davon aus, dass sie die Zahl ihrer Mitarbeiter im nächste halben Jahr reduzieren müssen.
Diese Aussichten entsprechen in etwa der derzeitigen Lage der selbstständigen Unternehmer. Knapp 30 Prozent sagten, sie seien stark (20,1 Prozent) bis sehr stark (9,1 Prozent) von der Rezession betroffen. Gut 70 Prozent gaben dagegen an, die Rezession betreffe ihr Unternehmen kaum (55,2 Prozent) oder gar nicht (15,4 Prozent).
Die größten Investitionshemmnisse sehen die Unternehmer zurzeit demnach nicht in konjunkturbedingten Absatzproblemen (44,6 Prozent), sondern vielmehr in der Höhe der Steuer- und Abgabenlast (61,9 Prozent). An zweiter Stelle stehen die "arbeitsrechtlichen Regulierungen" (55,2 Prozent) gefolgt von "Unberechenbarkeit von Finanz- und Wirtschaftspolitik" (48,7) und Bürokratielasten (47,3). Über Fachkräftemangel als Investitionshemmnis klagen den Angaben zufolge immerhin 27,6 Prozent.
http://www.n-tv.de/1107732.html
Familienfirmen kämpfen
Die Familienunternehmer in Deutschland versuchen, auch in der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise Arbeitsplätze zu erhalten. In einer Umfrage der Verbände der Familienunternehmer und der Jungen Unternehmer unter 512 Unternehmern gaben knapp 60 Prozent der Befragten an, in den nächsten sechs Monaten die Zahl ihrer Mitarbeiter konstant halten zu wollen. Rund 16 Prozent wollen neue Arbeitsplätze schaffen. Knapp 24 Prozent gehen dagegen davon aus, dass sie die Zahl ihrer Mitarbeiter im nächste halben Jahr reduzieren müssen.
Diese Aussichten entsprechen in etwa der derzeitigen Lage der selbstständigen Unternehmer. Knapp 30 Prozent sagten, sie seien stark (20,1 Prozent) bis sehr stark (9,1 Prozent) von der Rezession betroffen. Gut 70 Prozent gaben dagegen an, die Rezession betreffe ihr Unternehmen kaum (55,2 Prozent) oder gar nicht (15,4 Prozent).
Die größten Investitionshemmnisse sehen die Unternehmer zurzeit demnach nicht in konjunkturbedingten Absatzproblemen (44,6 Prozent), sondern vielmehr in der Höhe der Steuer- und Abgabenlast (61,9 Prozent). An zweiter Stelle stehen die "arbeitsrechtlichen Regulierungen" (55,2 Prozent) gefolgt von "Unberechenbarkeit von Finanz- und Wirtschaftspolitik" (48,7) und Bürokratielasten (47,3). Über Fachkräftemangel als Investitionshemmnis klagen den Angaben zufolge immerhin 27,6 Prozent.
http://www.n-tv.de/1107732.html
US-Ökonom Roubini im stern: "Die Weltwirtschaft ist im freien Fall"
Hamburg (ots) - Der amerikanische Wirtschaftsprofessor Nouriel Roubini sieht die Weltwirtschaft "im freien Fall" und die deutsche Wirtschaft in einer schlechteren Verfassung als die der USA . "Rechnet man die aktuellen Zahlen für das vierte Quartal 2008 aufs Jahr hoch, dann fällt die Wirtschaftsleistung im Moment um acht Prozent. Damit geht es Deutschland zurzeit schlechter als den USA", sagte er in einem Interview in der neuen, am Donnerstag erscheinenden Ausgabe des stern. Rechne man die jüngsten Zahlen für die Länder der Eurozone aufs Jahr hoch, käme man auf einen Rückgang von bis zu sechs Prozent. In Japan wären es laut Roubini sogar zwölf Prozent, in den USA dagegen "nur" 3,8 Prozent.
Der US-Professor, der die Finanzkrise richtig vorhergesagt hatte und seither "Dr. Doom", also Dr. Untergang genannt wird, äußerte sich besonders besorgt über die Dynamik der A bschwächung: "Diese Krisen verlaufen sehr schnell. Und sie verlaufen gleichzeitig." Früher seien Krisen in einem Land durch Wachstum in anderen Ländern abgefedert worden. "Doch jetzt ist die Weltwirtschaft buchstäblich im freien Fall." Roubini sagt der Weltkonjunktur eine lange Durstrecke voraus. Sie habe im Dezember 2007 angefangen - " und wenn wir Glück haben, dann wird es vielleicht Ende 2010 langsam besser". Doch es sei auch möglich, dass es viel länger dauere, warnte der Ökonom im stern: "Ich glaube, die Weltwirtschaft wird in eine Phase der Deflation eintreten: fallende Preise, auch für Rohstoffe, steigende Arbeitslosigkeit." Eine weltweite Stagnation über Jahre, das sei das größte Risiko.
Der 50-Jährige rügte im stern, dass die europäischen Politiker die Folgen der US-Krise "massiv unterschätzt" hätten. Der Kontinent hinke bei der Krisenbekämpfung immer noch hinterher: "Europa hat bislang zu wenig getan." Offenbar handele man nach dem Motto: "zu wenig, zu spät". Roubini forderte weitere Zinssenkungen: "Die Zinsen der Zentralbanken sind immer noch zu hoch. Sie sollten bei null Prozent liegen." Außerdem seien Steuererleichterungen, umfassende Konjunkturpakete und Hilfen für notleidende Banken erforderlich.
Hamburg (ots) - Der amerikanische Wirtschaftsprofessor Nouriel Roubini sieht die Weltwirtschaft "im freien Fall" und die deutsche Wirtschaft in einer schlechteren Verfassung als die der USA . "Rechnet man die aktuellen Zahlen für das vierte Quartal 2008 aufs Jahr hoch, dann fällt die Wirtschaftsleistung im Moment um acht Prozent. Damit geht es Deutschland zurzeit schlechter als den USA", sagte er in einem Interview in der neuen, am Donnerstag erscheinenden Ausgabe des stern. Rechne man die jüngsten Zahlen für die Länder der Eurozone aufs Jahr hoch, käme man auf einen Rückgang von bis zu sechs Prozent. In Japan wären es laut Roubini sogar zwölf Prozent, in den USA dagegen "nur" 3,8 Prozent.
Der US-Professor, der die Finanzkrise richtig vorhergesagt hatte und seither "Dr. Doom", also Dr. Untergang genannt wird, äußerte sich besonders besorgt über die Dynamik der A bschwächung: "Diese Krisen verlaufen sehr schnell. Und sie verlaufen gleichzeitig." Früher seien Krisen in einem Land durch Wachstum in anderen Ländern abgefedert worden. "Doch jetzt ist die Weltwirtschaft buchstäblich im freien Fall." Roubini sagt der Weltkonjunktur eine lange Durstrecke voraus. Sie habe im Dezember 2007 angefangen - " und wenn wir Glück haben, dann wird es vielleicht Ende 2010 langsam besser". Doch es sei auch möglich, dass es viel länger dauere, warnte der Ökonom im stern: "Ich glaube, die Weltwirtschaft wird in eine Phase der Deflation eintreten: fallende Preise, auch für Rohstoffe, steigende Arbeitslosigkeit." Eine weltweite Stagnation über Jahre, das sei das größte Risiko.
Der 50-Jährige rügte im stern, dass die europäischen Politiker die Folgen der US-Krise "massiv unterschätzt" hätten. Der Kontinent hinke bei der Krisenbekämpfung immer noch hinterher: "Europa hat bislang zu wenig getan." Offenbar handele man nach dem Motto: "zu wenig, zu spät". Roubini forderte weitere Zinssenkungen: "Die Zinsen der Zentralbanken sind immer noch zu hoch. Sie sollten bei null Prozent liegen." Außerdem seien Steuererleichterungen, umfassende Konjunkturpakete und Hilfen für notleidende Banken erforderlich.
Euro-Krisenländer
Notfalls gemeinsame Hilfe
Bundesbank-Präsident Axel Weber hält in ganz extremen Notfällen Hilfen der Euro-Länder für in massive Zahlungsprobleme geratene Partnerländer für denkbar. "Wären bei einer extremen Zuspitzung der Lage gezielte Hilfen für einzelne Mitgliedsstaaten angesichts der außerordentlichen Notsituation unumgänglich, so müssten diese zwingend mit strikten Anforderungen und Auflagen verbunden sein", sagte Weber der Tageszeitung "Die Welt".
Grundsätzlich könne es nicht um eine Form von Gemeinschaftshaftung gehen, sondern, wenn überhaupt, um "allenfalls gezielte Hilfen in außergewöhnlichen Notsituationen". Einen Eurobond, für den alle Euroländer einstehen würden, als Hilfeinstrument lehnte Weber ab. "Ein Eurobond wäre genau der falsche Weg", machte er deutlich.
Der Bundesbank-Präsident warnte aber vor einer Dramatisierung der Finanzprobleme in einigen Ländern der Euro-Zone. Die Frage, ob derzeit Staatspleiten in dieser Staatengruppe drohten, beantwortete er mit "Nein". Auch wenn die Zinsen von Staatsanleihen und die Ratings einiger Euroländer derzeit auseinanderklafften, bedeute das nicht, dass eine Solvenzkrise drohe.
Staaten, die nun höhere Zinsen auf ihre Anleihen zahlen müssten, hätten offensichtlich eingeschränkte finanzielle Spielräume und teils in guten Zeiten nicht genügend dafür getan, ihre Haushalte in Ordnung zu bringen. Bei der Bewältigung dieser Probleme seien die betreffenden Länder in erster Linie selbst gefordert. "Es muss klar sein, dass die einzelnen Nationalstaaten die Verantwortung für ihre Fiskalpolitik tragen", unterstrich der Bundesbank-Präsident.
In der Finanzkrise sind unter anderem Irland und Griechenland massiv unter Druck geraten. In den vergangenen Wochen wurde deswegen bereits über Staatsbankrotte und deren Folgen für die Gemeinschaftswährung diskutiert.
http://www.n-tv.de/1109496.html
Notfalls gemeinsame Hilfe
Bundesbank-Präsident Axel Weber hält in ganz extremen Notfällen Hilfen der Euro-Länder für in massive Zahlungsprobleme geratene Partnerländer für denkbar. "Wären bei einer extremen Zuspitzung der Lage gezielte Hilfen für einzelne Mitgliedsstaaten angesichts der außerordentlichen Notsituation unumgänglich, so müssten diese zwingend mit strikten Anforderungen und Auflagen verbunden sein", sagte Weber der Tageszeitung "Die Welt".
Grundsätzlich könne es nicht um eine Form von Gemeinschaftshaftung gehen, sondern, wenn überhaupt, um "allenfalls gezielte Hilfen in außergewöhnlichen Notsituationen". Einen Eurobond, für den alle Euroländer einstehen würden, als Hilfeinstrument lehnte Weber ab. "Ein Eurobond wäre genau der falsche Weg", machte er deutlich.
Der Bundesbank-Präsident warnte aber vor einer Dramatisierung der Finanzprobleme in einigen Ländern der Euro-Zone. Die Frage, ob derzeit Staatspleiten in dieser Staatengruppe drohten, beantwortete er mit "Nein". Auch wenn die Zinsen von Staatsanleihen und die Ratings einiger Euroländer derzeit auseinanderklafften, bedeute das nicht, dass eine Solvenzkrise drohe.
Staaten, die nun höhere Zinsen auf ihre Anleihen zahlen müssten, hätten offensichtlich eingeschränkte finanzielle Spielräume und teils in guten Zeiten nicht genügend dafür getan, ihre Haushalte in Ordnung zu bringen. Bei der Bewältigung dieser Probleme seien die betreffenden Länder in erster Linie selbst gefordert. "Es muss klar sein, dass die einzelnen Nationalstaaten die Verantwortung für ihre Fiskalpolitik tragen", unterstrich der Bundesbank-Präsident.
In der Finanzkrise sind unter anderem Irland und Griechenland massiv unter Druck geraten. In den vergangenen Wochen wurde deswegen bereits über Staatsbankrotte und deren Folgen für die Gemeinschaftswährung diskutiert.
http://www.n-tv.de/1109496.html