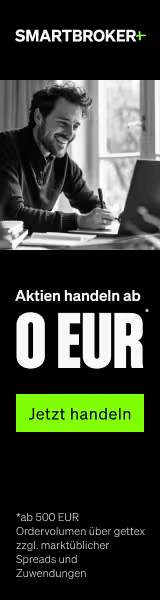07. März 2009, 17:58 Uhr
EINKAUFSTOURISMUS IN POLEN
Deutsche im Discount-Paradies
Von Nana Gerritzen
Waschmaschinen, Kühlschränke, Flachbildfernseher: Seit die polnische Währung immer mehr an Wert verliert, lohnt sich der grenzübergreifende Shopping-Tourismus für Deutsche ganz besonders. Selbst aus Berlin kommen die Schnäppchenjäger.
Frankfurt an der Oder/Slubice - Das Erste, was man sieht, wenn man die Stadtbrücke von Frankfurt an der Oder in Richtung Slubice, Polen überquert, ist ein großes Transparent mit der Aufschrift "Sie überschreiten jetzt die Preisgrenze". Mit leeren Einkaufstaschen und Körben machen Männer und Frauen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem PKW rüber. Ein paar Stunden später kehren sie vollbepackt mit Lebensmitteln, Zigaretten und einem Kanister Benzin im Kofferraum auf die deutsche Seite zurück. An sich sind deutsche Einkaufstouristen in Polen nichts Neues. Seit einigen Wochen aber sind die nicht nur auf der Jagd nach Zigaretten und Gemüse, sondern auch nach größeren Mitbringseln: Möbel und Waschmaschinen, Kühlschränke und Flachbildfernseher.
Wegen des günstigen Wechselkurses ist der Einkauf im Nachbarland für die Deutschen noch viel billiger geworden. Seit dem Zusammenbruch der Lehman Brothers im vergangenen September ist die polnische Währung auf Talfahrt, bisher ist kein Ende in Sicht. Bekam man pro Euro im vergangenen Sommer noch 3,19 Zloty, waren es am letzten Montag schon 4,68 Zloty. Auch innerhalb der letzten Woche ist die polnische Währung weiter gefallen. Am Freitag stand der Wechselkurs bei 4,75 Zloty pro Euro.
Auf den Parkplätzen der Einkaufszentren stehen nun immer öfter Autos mit deutschen Kennzeichen. Sie kommen nicht nur aus dem benachbarten Frankfurt/Oder, sondern auch von weiter her: aus Fürstenwalde etwa, sogar aus dem 100 Kilometer entfernten Berlin. Am ersten Wochenende des Monats sei besonders viel los, erzählt eine Taxifahrerin. "Wenn die Leute ihr Gehalt bekommen, tragen sie es direkt rüber."
Butter, die schön braun wird
Horst Vietz fährt sogar jede Woche die 40 Kilometer aus Fürstenwalde nach Polen. "Schon immer", wie er sagt. Seit knapp zwanzig Jahren meint er damit. Vietz kauft eigentlich alles in Polen: Blumen für seine Nachbarin "weil ja bald Frauentag ist", polnische Butter "weil die beim Braten schön braun wird" und Zywiec-Bier: "Das ist das Beste!"
Doch auch größere Sachen hat der 71-Jährige schon in Polen gekauft. Anzüge für den Sohn, einen Motorradhelm für die Tochter, Fahrräder für die halbe Nachbarschaft. "Die kosten bei uns mindestens 200 Euro, hier kriege ich sie für die Hälfte", sagt er. "Auch meine Reifen fürs Auto habe ich hier gekauft, einen Satz Sommerreifen und einen Satz Winterreifen." Im Moment denkt er über die Anschaffung größerer Elektrogeräte nach.
Zwanzig bis dreißig Prozent seiner Kunden kämen aus Deutschland, erzählt Radoslaw Bala, Geschäftsführer des Media Expert-Marktes in Slubice. "Die Umsätze steigen." An den vergangenen Wochenenden sei der Umsatz doppelt so hoch gewesen wie normalerweise. "Früher kamen auch schon Deutsche, aber sie haben nur geguckt und höchstens mal einen Wasserkocher oder eine CD gekauft", sagt Bala. Seit einem guten Monat aber gehe alles mögliche über die Ladentheke und Landesgrenze: Waschmaschinen und Kühlschränke, LCD-Fernseher und Digitalkameras und sogar ganze Heimkinoanlagen.
"Ich nutze das schon aus"
Besonders bei größeren Anschaffungen lohnt sich der günstige Tauschkurs. Für einen Bosch-Kühl- und Gefrierschrank, der im deutschen Fachhandel 650 Euro kostet bezahlt man bei Media Expert umgerechnet nur 426 Euro. Ein 32-Zoll-LCD-Fernseher von Sony, der im deutschen Elektro-Discountmarkt für 600 Euro angeboten wird, kostet hier nur 430 Euro.
Media Expert ist der größte Elektrofachmarkt in Slubice, doch im Vergleich mit den großen Discount-Geschäften im Nachbarland ist die Verkaufsfläche ziemlich klein. Wegen des steigenden Umsatzes wird das Geschäft seit kurzem täglich mit neuen Produkten beliefert. Was nicht in den Laden passt, wird einfach vor die Tür gestellt. Abends ist von der verstärkten Anlieferung meist nur noch ein Haufen Kartons und Styropor übrig.
"Der Zloty ist da, wo er hingehört", sagt Horst Vietz über den günstigen Wechselkurs. "Ich nutze das schon aus", gibt er zu. Doch auch für die Polen sei die gesunkene Währung gut. "Die nehmen jetzt mehr Euros ein und das füllt die polnische Staatskasse."
Um den wöchentlichen Einkauf zu erleichtern, hat Vietz ein Portemonnaie mit Euros und eines mit polnischem Geld. Viele seiner Bekannten, erzählt er, würden nicht nach Polen fahren, "die haben noch Vorurteile". Auch er selbst habe anfangs etwas Angst um sein Auto gehabt, aber schnell gemerkt, dass das Quatsch sei. "Die fahren teilweise viel bessere Autos als wir, ich hab schon Polen mit Jaguar und Geländewagen gesehen", berichtet Vietz. Etwas Polnisch hat er auf seinen wöchentlichen Einkaufsfahrten auch schon gelernt. "Meine Tochter sagt immer: Du bist ein halber Pole", sagt Vietz.
Die polnischen Händler sind gut vorbereitet auf die deutsche Kundschaft. Alle Geschäfte werben in beiden Sprachen für die zum Verkauf angebotenen Produkte, es gibt keinen Laden, in dem nicht zumindest einer der Angestellten fließend deutsch spricht. "Alles schmeckt wunderbar", sagt die Wirtin einer Imbissbude am Slubicer Basar über ihr Angebot. Ihren polnischen Akzent kann man kaum erahnen. Aus den Boxen ihrer Stereoanlage dröhnen deutsche Schlager. Die Shopping-Pendler freuen sich über Bauernfrühstück, Schnitzel und Bockwurst zu Tiefstpreisen. Dazu gibt es Senf aus Bautzen.
Was ist das denn ...
Zloty bis zu 50 % ABGEWERTET seit Anfang Oktober :shock:
Eur/Zloty 4,7245



EINKAUFSTOURISMUS IN POLEN
Deutsche im Discount-Paradies
Von Nana Gerritzen
Waschmaschinen, Kühlschränke, Flachbildfernseher: Seit die polnische Währung immer mehr an Wert verliert, lohnt sich der grenzübergreifende Shopping-Tourismus für Deutsche ganz besonders. Selbst aus Berlin kommen die Schnäppchenjäger.
Frankfurt an der Oder/Slubice - Das Erste, was man sieht, wenn man die Stadtbrücke von Frankfurt an der Oder in Richtung Slubice, Polen überquert, ist ein großes Transparent mit der Aufschrift "Sie überschreiten jetzt die Preisgrenze". Mit leeren Einkaufstaschen und Körben machen Männer und Frauen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem PKW rüber. Ein paar Stunden später kehren sie vollbepackt mit Lebensmitteln, Zigaretten und einem Kanister Benzin im Kofferraum auf die deutsche Seite zurück. An sich sind deutsche Einkaufstouristen in Polen nichts Neues. Seit einigen Wochen aber sind die nicht nur auf der Jagd nach Zigaretten und Gemüse, sondern auch nach größeren Mitbringseln: Möbel und Waschmaschinen, Kühlschränke und Flachbildfernseher.
Wegen des günstigen Wechselkurses ist der Einkauf im Nachbarland für die Deutschen noch viel billiger geworden. Seit dem Zusammenbruch der Lehman Brothers im vergangenen September ist die polnische Währung auf Talfahrt, bisher ist kein Ende in Sicht. Bekam man pro Euro im vergangenen Sommer noch 3,19 Zloty, waren es am letzten Montag schon 4,68 Zloty. Auch innerhalb der letzten Woche ist die polnische Währung weiter gefallen. Am Freitag stand der Wechselkurs bei 4,75 Zloty pro Euro.
Auf den Parkplätzen der Einkaufszentren stehen nun immer öfter Autos mit deutschen Kennzeichen. Sie kommen nicht nur aus dem benachbarten Frankfurt/Oder, sondern auch von weiter her: aus Fürstenwalde etwa, sogar aus dem 100 Kilometer entfernten Berlin. Am ersten Wochenende des Monats sei besonders viel los, erzählt eine Taxifahrerin. "Wenn die Leute ihr Gehalt bekommen, tragen sie es direkt rüber."
Butter, die schön braun wird
Horst Vietz fährt sogar jede Woche die 40 Kilometer aus Fürstenwalde nach Polen. "Schon immer", wie er sagt. Seit knapp zwanzig Jahren meint er damit. Vietz kauft eigentlich alles in Polen: Blumen für seine Nachbarin "weil ja bald Frauentag ist", polnische Butter "weil die beim Braten schön braun wird" und Zywiec-Bier: "Das ist das Beste!"
Doch auch größere Sachen hat der 71-Jährige schon in Polen gekauft. Anzüge für den Sohn, einen Motorradhelm für die Tochter, Fahrräder für die halbe Nachbarschaft. "Die kosten bei uns mindestens 200 Euro, hier kriege ich sie für die Hälfte", sagt er. "Auch meine Reifen fürs Auto habe ich hier gekauft, einen Satz Sommerreifen und einen Satz Winterreifen." Im Moment denkt er über die Anschaffung größerer Elektrogeräte nach.
Zwanzig bis dreißig Prozent seiner Kunden kämen aus Deutschland, erzählt Radoslaw Bala, Geschäftsführer des Media Expert-Marktes in Slubice. "Die Umsätze steigen." An den vergangenen Wochenenden sei der Umsatz doppelt so hoch gewesen wie normalerweise. "Früher kamen auch schon Deutsche, aber sie haben nur geguckt und höchstens mal einen Wasserkocher oder eine CD gekauft", sagt Bala. Seit einem guten Monat aber gehe alles mögliche über die Ladentheke und Landesgrenze: Waschmaschinen und Kühlschränke, LCD-Fernseher und Digitalkameras und sogar ganze Heimkinoanlagen.
"Ich nutze das schon aus"
Besonders bei größeren Anschaffungen lohnt sich der günstige Tauschkurs. Für einen Bosch-Kühl- und Gefrierschrank, der im deutschen Fachhandel 650 Euro kostet bezahlt man bei Media Expert umgerechnet nur 426 Euro. Ein 32-Zoll-LCD-Fernseher von Sony, der im deutschen Elektro-Discountmarkt für 600 Euro angeboten wird, kostet hier nur 430 Euro.
Media Expert ist der größte Elektrofachmarkt in Slubice, doch im Vergleich mit den großen Discount-Geschäften im Nachbarland ist die Verkaufsfläche ziemlich klein. Wegen des steigenden Umsatzes wird das Geschäft seit kurzem täglich mit neuen Produkten beliefert. Was nicht in den Laden passt, wird einfach vor die Tür gestellt. Abends ist von der verstärkten Anlieferung meist nur noch ein Haufen Kartons und Styropor übrig.
"Der Zloty ist da, wo er hingehört", sagt Horst Vietz über den günstigen Wechselkurs. "Ich nutze das schon aus", gibt er zu. Doch auch für die Polen sei die gesunkene Währung gut. "Die nehmen jetzt mehr Euros ein und das füllt die polnische Staatskasse."
Um den wöchentlichen Einkauf zu erleichtern, hat Vietz ein Portemonnaie mit Euros und eines mit polnischem Geld. Viele seiner Bekannten, erzählt er, würden nicht nach Polen fahren, "die haben noch Vorurteile". Auch er selbst habe anfangs etwas Angst um sein Auto gehabt, aber schnell gemerkt, dass das Quatsch sei. "Die fahren teilweise viel bessere Autos als wir, ich hab schon Polen mit Jaguar und Geländewagen gesehen", berichtet Vietz. Etwas Polnisch hat er auf seinen wöchentlichen Einkaufsfahrten auch schon gelernt. "Meine Tochter sagt immer: Du bist ein halber Pole", sagt Vietz.
Die polnischen Händler sind gut vorbereitet auf die deutsche Kundschaft. Alle Geschäfte werben in beiden Sprachen für die zum Verkauf angebotenen Produkte, es gibt keinen Laden, in dem nicht zumindest einer der Angestellten fließend deutsch spricht. "Alles schmeckt wunderbar", sagt die Wirtin einer Imbissbude am Slubicer Basar über ihr Angebot. Ihren polnischen Akzent kann man kaum erahnen. Aus den Boxen ihrer Stereoanlage dröhnen deutsche Schlager. Die Shopping-Pendler freuen sich über Bauernfrühstück, Schnitzel und Bockwurst zu Tiefstpreisen. Dazu gibt es Senf aus Bautzen.
Was ist das denn ...
Zloty bis zu 50 % ABGEWERTET seit Anfang Oktober :shock:
Eur/Zloty 4,7245