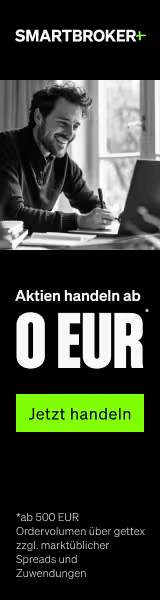Das rote Imperium wird grün......
China baut seine Solar- und Windindustrie zur neuen Ökogroßmacht aus. Dank der Milliardenaufträge aus dem Inland werden sie noch mächtiger und können Wettbewerber in aller Welt noch leichter auf deren Heimatmärkten angreifen. Die deutsche Grünstrom-Branche wird von der Konkurrenz aus Fernost geradezu überrollt.
PEKING. Einladend ist die Gegend nördlich von Baotou nicht. Schon kurz hinter der gesichtslosen Industriestadt in der Inneren Mongolei, 650 Kilometer nordwestlich von Peking, stehen kaum noch Bäume. Je weiter der Weg nordwärts führt, desto seltener werden auch Sträucher und Büsche. Übrig bleiben staubige Straßen, karge Hügel - und beißender Wind.
Er macht die öde Steppe im Norden Chinas zum Lieblingsstandort der Windanlagenbetreiber. Schon jetzt reiht sich ein riesiger Windpark an den anderen. Wohin man blickt, in allen Himmelsrichtungen drehen sich die Windräder.
Es sollen noch viel mehr werden. Auf der Windfarm des Stromversorgers Zhangze aus der Nachbarprovinz Shanxi zum Beispiel stehen heute 33 Turbinen mit einer Leistung von 50 Megawatt (MW). Sie versorgen rund 40 000 Haushalte mit Elektrizität. "Bald werden es 200 Megawatt sein", berichtet Windpark-Manager Guo Juyang. Fast alle chinesischen Betreiber verfolgen ähnlich ambitionierte Ausbauziele.
Die Regierung in Peking unterstützt sie nach Kräften: So erhalten Windmüller etwa das Land für ihre Mühlen kostenlos. Mit ihrer Windstrom-Offensive verfolgt die chinesische Regierung einen kühnen Plan: Sie will große Teile der Energieversorgung auf saubere Quellen umstellen.
Das ist bitter nötig. Derzeit geht in China fast jede Woche ein neues Kohlekraftwerk ans Netz. Doch noch schneller will die Pekinger Regierung bis 2020 die Kernkraft und die erneuerbaren Energien ausbauen: Atom von 9 auf 86 Gigawatt (GW) Leistung, Wasserkraft von 196 auf 300 GW, Wind von 16 auf 150 GW, Solar von weniger als einem auf 20 GW. So soll der Anteil der Kohlekraftwerke am Strombedarf in zehn Jahren von 74 Prozent auf 61 Prozent schrumpfen.
Das lässt sich die Regierung einiges kosten. Im Fünfjahresplan des Pekinger Regimes, der 2011 in Kraft tritt, sind Medienberichten zufolge umgerechnet mehr als 540 Milliarden Euro für alternative Energien vorgesehen. Das wäre gut zehn Mal mehr, als Deutschland in diesem Zeitraum in den boomenden Sektor stecken will.
Gefragtes Investitionsziel Der grüne chinesische Aufbruch lockt massiv Investoren an. 11,5 Milliarden Dollar investierten internationale Banken, Versicherungen und Pensionsfonds im zweiten Quartal dieses Jahres in Öko-kraftwerke und Biotreibstoffanlagen. Laut einer aktuellen Studie der Finanzanalysten von Bloomberg New Energy Finance (BNEF) war das erstmals mehr, als Investoren zur gleichen Zeit in die grünen Leitmärkte USA und Europa investierten
Mit dem Energieschwenk will Chinas Führung zum einen nach der Solar- auch die Windindustrie zur weltweiten Nummer eins machen. Noch haben europäische und US-Unternehmen dort die Nase vorn. Zum anderen soll die rasante Zerstörung der Umwelt gebremst werden.
Sie hat dramatische Ausmaße angenommen. In Städten erkranken wegen der oft extremen Luftverschmutzung Abertausende Menschen an Bronchitis, Lungenentzündungen und Lungenkrebs. Nach Untersuchungen der Weltbank sterben jährlich 750 000 Chinesen an den Folgen dieser Erkrankungen. Ebenso beunruhigt die Funktionäre, dass die Verschmutzung von Luft, Flüssen und Seen das Land inzwischen nach inoffiziellen Berechnungen jährlich zwischen fünf und acht Prozent seiner Wirtschaftsleistung kostet.
Was Chinas Bürgern guttut, ist für die deutschen Hersteller von Solar- und Windanlagen Gift: Denn die asiatische Konkurrenz droht, sie an die Wand zu drücken. Chinesische Windanlagenhersteller wie Goldwind und Sinovel oder die Solarspezialisten Suntech, Yingli und JA Solar gehören schon heute zu den Großen.
Dank der Milliardenaufträge aus dem Inland werden sie noch mächtiger und können Wettbewerber in aller Welt noch leichter auf deren Heimatmärkten angreifen. "China fährt eine aggressive Expansionsstrategie", sagt Wolfgang Hummel, Energieexperte an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Berlin.
Die deutschen Hersteller könnten dem gelassener entgegensehen, hätten sie selbst faire Chancen, vom Grünstrom-boom in China zu profitieren. Doch davon kann keine Rede sein. Die Pekinger Regierung schließt ausländische Unternehmen von der Auftragsvergabe meist rigoros aus. Selten geschieht dies explizit. Ausländer werden stattdessen mit allerlei Verfahrenstricks ausgebootet. "Wir sind trotz vieler Versuche nicht einmal an die Ausschreibungsunterlagen gekommen", berichtet etwa Milan Nitzschke, Marketingchef des Bonner Herstellers Solarworld.
Nicht anders ergeht es den Windmüllern aus Deutschland und Europa. Dabei hatten gerade sie gehofft, am chinesischen Windboom partizipieren zu können: Allein 2010 wurden dort schon mehr als neun Gigawatt installiert. Das entspricht in etwa der Leistung von neun großen Kohlekraftwerken. "China ist innerhalb weniger Jahre zum größten Markt für Windenergie herangewachsen und hat Deutschland überholt", bestätigt Steve Sawyer, Generalsekretär des Windenergierats Global Wind Energy Council.
Technologische Aufholjagd In der Erwartung, erkleckliche Teile der Aufträge zu ergattern, haben große Windradbauer wie der dänische Weltmarktführer Vestas oder Nordex und Repower aus Deutschland Fabriken in China gebaut. Doch das Geschäft machen zu 80 Prozent einheimische Anbieter. Ihre Anlagen sind 20 bis 30 Prozent billiger, die Windräder der führenden Hersteller wie Goldwind sind qualitativ jedoch schon nahezu mit europäischen Standards vergleichbar.
Goldwind ist ein Paradefall für die Strategie, mit der sich chinesische Newcomer bei Zukunftstechnologien in kurzer Zeit noch oben arbeiten. Vor acht Jahren kaufte das Unternehmen eine Lizenz von Repower und startete damit in Xinjiang im Nordwesten Chinas die Herstellung seiner ersten Windkraftanlagen. Inzwischen betreibt Goldwind acht Fabriken in China und verbessert die Leistungsfähigkeit seiner Windräder mit einer eigenen Entwicklungsabteilung und öffentlicher Forschung auf Spitzenniveau.
Das Geschäft explodiert geradezu. Im vergangenen Jahr verkaufte Goldwind gut 2000 Anlagen, in diesem Jahr werden es voraussichtlich 4450 sein. Längst sind die Chinesen bei Umsatz und Wachstum am deutschen Geburtshelfer vorbeigezogen.
Mit dem Heimvorteil im Rücken rüsten sich auch Windbauer wie Sinovel, Dongfang oder United Power systematisch für den nächsten Schritt: die Eroberung des Weltmarkts. "Die Qualitätslücke zwischen chinesischen und ausländischen Turbinen schließt sich allmählich", schreiben die Experten der Investmentbank Goldman Sachs in einer Studie. Und prognostizieren eine baldige Exportoffensive.
Das an der Hongkonger Börse gelistete Unternehmen Goldwind etwa will spätestens in fünf Jahren ein Drittel seines Umsatzes im Ausland erzielen. Und dort auch produzieren. Denn weil es viel zu teuer wäre, die riesigen Gondeln, Rotorblätter und Maschinenhäuser per Schiff zu transportieren, planen die Asiaten eigene Werke in den USA und Europa.
Goldwind hat den ersten Schritt bereits getan. Vor zwei Jahren schluckten die Chinesen den deutschen Hersteller Vensys im saarländischen Neunkirchen. Seit wenigen Wochen fertigen die Chinesen dort in nagelneuen Hallen Turbinen für den deutschen Markt.
Andere werden dem Beispiel folgen. "Dann haben wir die Chinesen vor der Tür", schwant dem Sprecher des Bundesverbands Windenergie, Ulf Gerder. Die neuen Wettbewerber verfolgen eine perfide Doppelstrategie: Einerseits saugen sie über Lizenzen und Joint Ventures mit westlichen Windunternehmen deren Know-how ab. Zum anderen stellt die Pekinger Regierung billige Kredite für die Expansion bereit und schottet zugleich den eigenen Markt ab
Trotz dieser Praktiken halten sich westliche Unternehmen mit offiziellen Protesten zurück. Sie wissen, dass dies die chinesische Position nur verhärtewürde. Siemens kennt die Empfindlichkeiten der Chinesen aus vielen Großprojekten und sucht daher auch bei der Windkraft lieber den Modus der Zusammenarbeit: Insidern zufolge wollen die Münchner in Kürze ein Joint Venture mit dem Mischkonzern Shanghai Electric eingehen.
Auch Repower aus Hamburg, das in Baotou in der Inneren Mongolei eine Fertigung betreibt, will sich durch das eisige Geschäftsklima nicht entmutigen lassen. "Wir bleiben hier", sagt Wolfgang Jussen, CEO bei Repower in China.
Schlacht um den Solarmarkt In der Fotovoltaik spielen die Chinesen schon länger auf Augenhöhe zur westlichen Konkurrenz. Mehr noch: Sie sind laut HTW-Forscher Hummel gerade dabei, "die Schlacht um den Solarmarkt zu gewinnen. Unternehmen wie Suntech aus Wuxi bei Shanghai oder Yingli aus dem nordchinesischen Baoding bieten westliche Qualität zu Preisen, die laut den Solarexperten des Bonner Beratungshauses EuPD Research etwa 20 Prozent unter denen deutscher Rivalen liegen.
Noch größer ist der Vorsprung bei den Produktionskosten: Die besten chinesischen Hersteller fertigen ihre Module laut Hummel fast schon um die Hälfte billiger. Kein Wunder, dass die Nachfrage nach chinesischer Ware explodiert. Die Analysten von Goldman Sachs erwarten, dass Chinas Anbieter bereits Ende des Jahres 65 Prozent des Fotovoltaik-Weltmarktes kontrollieren - nach 50 Prozent 2009.
Setzt sich der Trend fort, spielen Hersteller aus anderen Ländern in wenigen Jahren nur noch eine Nebenrolle.
Die Deutschen hat dieses Schicksal auf dem heimischen Solarmarkt bereits ereilt. Er ist - dank der üppigen, staatlich verordneten Förderung über die Einspeisevergütung - der größte weltweit. Das zeigt eine Übersicht der Berliner HTW-Experten. Danach verkauften Solarworld, Bosch Solar & Co. im ersten Halbjahr dieses Jahres gerade einmal noch zwölf Prozent aller in Deutschland abgesetzten Module - chinesische Hersteller dagegen 35 Prozent. "Die haben den deutschen Markt überrollt", kommentiert Hummel die Entwicklung.
Rechnet man deutsche Handelsmarken hinzu, deren Produkte aus chinesischer Fertigung stammen, kommen bereits mehr als die Hälfte aller verbauten Solar-Paneele aus China.
Bestes Lehrstück, wie Chinas Solarindustrie ihren Siegeszug organisiert, ist der Aufstieg des größten Herstellers von Solaranlagen, Suntech Power, zur weltweiten Nummer zwei nach First Solar aus den USA. Um auf den größten Märkten in Europa und den USA Spitzenprodukte anbieten zu können, setzte Gründer und Vorstandschef Shi Zhengrong auf Know-how-Erwerb aus dem Ausland. 2006 kaufte er für rund 200 Millionen Dollar den japanischen Konkurrenten MSK. Die Japaner hatten ein Verfahren entwickelt, das Solarzellen in Glasfassaden unsichtbar macht. Damit war der Marktzutritt geschafft. Parallel baute Suntech zügig seine Produktionskapazitäten aus und verbesserte beständig seine eigene Technologie.
Am Stammsitz in Wuxi, wo das Unternehmen eine von insgesamt vier Fabriken betreibt, hat Shi ein riesiges Forschungs- und Entwicklungszentrum hochgezogen. Insgesamt 30 Millionen Dollar investieren die Chinesen jedes Jahr in die Forschung.
All das zahlt sich aus. Im vergangenen Jahr verkaufte Suntech Solarmodule im Wert von rund 1,7 Milliarden Dollar. Mehr als 95 Prozent des Umsatzes erzielt das Unternehmen, das seit fünf Jahren an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistet ist, außerhalb Chinas, fast 40 Prozent davon in Deutschland.
Und Suntechs Expansion schreitet voran. Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien und den USA haben die Chinesen bereits. Jetzt will Vorstandschef Shi die Märkte Osteuropas und des östlichen Mittelmeerraums erschließen. Andere chinesische Solarriesen wie Yingli, Trina Solar oder LDK Solar bauen ihre Marktposition nach ähnlichem Muster aus.
Haben die deutschen Hersteller angesichts dieser Übermacht und der Kostenvorteile der Asiaten überhaupt eine Überlebenschance? Experte Hummel ist skeptisch. "Der Solarbranche droht das gleiche Schicksal wie vor wenigen Jahrzehnten der deutschen Elektronikindustrie. Die Produktion verschwindet nach Asien."