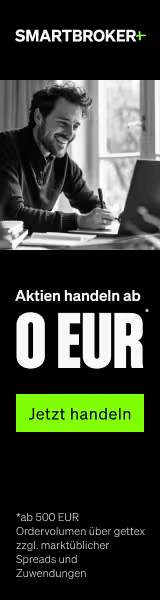AP
Bofinger sieht schlimmste Finanzkrise seit Zweitem Weltkrieg
Samstag 22. März 2008, 09:47 Uhr
Zum Thema
Hamburg (AP) Der Wirtschaftsweise Peter Bofinger sieht das internationale Finanzsystem in der schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg und hat Banken wegen riskanter Geschäfte scharf kritisiert. «Kredite müssen in Zukunft wieder stärker über traditionelle Banken laufen und nicht über exotische Zwischenhändler», schrieb der Experte in einem Beitrag für die der «Bild am Sonntag». Der Staat müsse dafür sorgen, dass sich alle Beteiligten an die Regeln hielten. «Nur so werden die Finanzmärkte wieder sicherer.»
Zugleich zeigte sich Bofinger verwundert über den Ruf von Banken nach mehr Staat. Das Mitglied des Sachverständigenrates erklärte: «Gerade Anzeige
sie haben in den letzten Jahren alles getan, um staatliche Regeln zu umgehen. Die Devise lautete: Es müssen 25 Prozent Rendite her.» Für sichere Anlagen gebe es aber nur 4 Prozent Zinsen. Deswegen sei man hohe Risiken eingegangen und habe fragwürdige Geschäftsmodelle gewählt. «Wer auf der Landstraße eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 km/h erzielen will, muss schneller fahren als erlaubt und Überholverbote ignorieren. Das geht eine Zeit lang gut, aber früher oder später kommt der Crash.»
Angst um Ersparnisse seien aber unbegründet, schrieb Bofinger. «Die kranken Banken werden rund um die Uhr von den staatlichen Notenbanken betreut, ähnlich wie die Patienten auf der Intensivstation. Die Eingriffe erfolgen so professionell, dass Groß- und Kleinanleger keine Angst um ihre Ersparnisse haben müssen.» In den schlimmsten Fällen wie bei der Mittelstandsbank IKB helfe der Staat zusätzlich mit Steuergeldern aus. Die Hilfe für die Banken führte Bofinger auf das Ausmaß der Probleme zurück: «Das internationale Finanzsystem befindet sich in der schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg.»
Bofinger sieht schlimmste Finanzkrise seit Zweitem Weltkrieg
Samstag 22. März 2008, 09:47 Uhr
Zum Thema
Hamburg (AP) Der Wirtschaftsweise Peter Bofinger sieht das internationale Finanzsystem in der schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg und hat Banken wegen riskanter Geschäfte scharf kritisiert. «Kredite müssen in Zukunft wieder stärker über traditionelle Banken laufen und nicht über exotische Zwischenhändler», schrieb der Experte in einem Beitrag für die der «Bild am Sonntag». Der Staat müsse dafür sorgen, dass sich alle Beteiligten an die Regeln hielten. «Nur so werden die Finanzmärkte wieder sicherer.»
Zugleich zeigte sich Bofinger verwundert über den Ruf von Banken nach mehr Staat. Das Mitglied des Sachverständigenrates erklärte: «Gerade Anzeige
sie haben in den letzten Jahren alles getan, um staatliche Regeln zu umgehen. Die Devise lautete: Es müssen 25 Prozent Rendite her.» Für sichere Anlagen gebe es aber nur 4 Prozent Zinsen. Deswegen sei man hohe Risiken eingegangen und habe fragwürdige Geschäftsmodelle gewählt. «Wer auf der Landstraße eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 km/h erzielen will, muss schneller fahren als erlaubt und Überholverbote ignorieren. Das geht eine Zeit lang gut, aber früher oder später kommt der Crash.»
Angst um Ersparnisse seien aber unbegründet, schrieb Bofinger. «Die kranken Banken werden rund um die Uhr von den staatlichen Notenbanken betreut, ähnlich wie die Patienten auf der Intensivstation. Die Eingriffe erfolgen so professionell, dass Groß- und Kleinanleger keine Angst um ihre Ersparnisse haben müssen.» In den schlimmsten Fällen wie bei der Mittelstandsbank IKB helfe der Staat zusätzlich mit Steuergeldern aus. Die Hilfe für die Banken führte Bofinger auf das Ausmaß der Probleme zurück: «Das internationale Finanzsystem befindet sich in der schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg.»